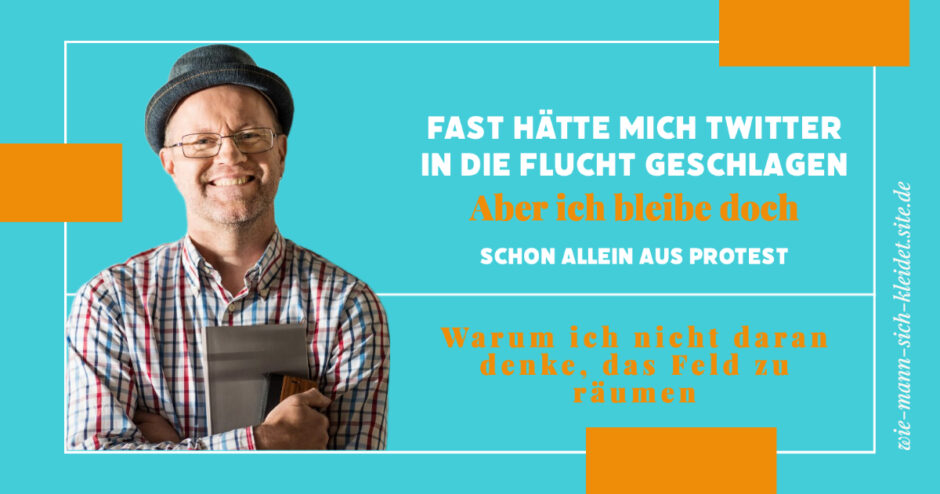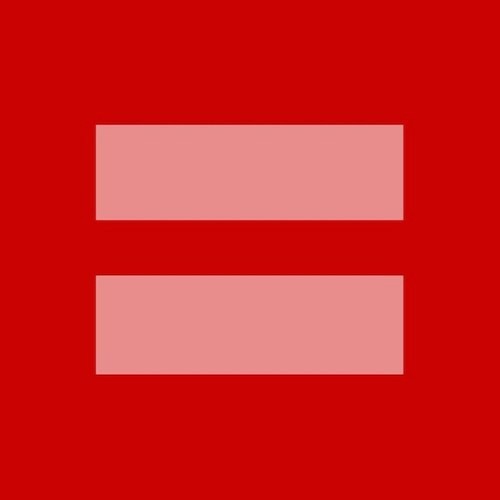Älterwerden und Altwerden sind glücklicherweise zwei verschiedene Zustände. Dennoch kommt es vor, dass ich mich frage: Werde ich alt? Nicht wegen körperlicher Gebrechen oder Vergesslichkeit, sondern wegen Verhaltensweisen, dir mir, als Älterwerdender, wie die eines Altwerdenden vorkommen.
Eine dieser schrulligen Verhaltensweisen, die sich mir angeheftet haben, ist das interessierte Durchblättern der kostenlosen Wochenendzeitung. Vor ewigen Jahren habe ich sie selbst eine Weile lang ausgetragen. Ich war durch meinen damaligen Wohnort gewandert und hatte fremden Menschen das in ihre Briefkästen gestopft, was im Fachjargon allen Ernstes „Werbeträger“ heißt – also gedrucktes Drumherum, um darin Werbeprospekte zu versenken. Damals war ich erstaunt, dass manche Leute schon in ihren geöffneten Fenstern lagen, weil sie so sehr darauf gewartet hatten. Es gab manche, die sich bei mir beschwerten, dass ich so spät kam. Ein Mensch beschwerte sich sogar bei der Firma über mich. Ich käme erst am Vormittag, dabei vermisste man das Blättchen bereits zum Frühstück.
Ich fragte mich damals, was diese Menschen nur an diesen kostenlosen Werbeträger-Blättchen finden mochten.
Nun bin ich selbst einer geworden, der sie Woche für Woche durchblättert. Immerhin vermisse ich sie nicht morgens, manchmal ist sie erst Sonntag da statt Samstag, und das ist mir noch immer egal. Aber wenn sie da ist, blättere ich sie aufmerksam durch, lese gar manche Beiträge.
Was ist bloß mit mir los?
Vielleicht einfach gar nichts oder vielleicht eine Menge.
Früher habe ich diese Druckerzeugnisse respektive Werbeträger mit dem Aufkleber „Keine kostenlose Werbung und kostenlosen Zeitungen“ abgewehrt. Bis die Hausverwaltung entschied, uns allen der schöneren Optik wegen einheitliche Aufkleber zu verpassen – auf denen lediglich „Keine kostenlose Werbung“ stand. Fortan also hatte sich das kostenlose Zeitungswerbeträgerding in meinen Briefkasten und somit in mein Leben geschoben. Nach dem Motto „Wenn sie schon da ist, kann ich auch reinschauen“ muss es irgendwann passiert sein: Gewöhnung setzte ein. Ich mutmaße, das es der gleiche Impuls so vieler Leute sein könnte, abends einfach den Fernseher einzuschalten, um „fernzusehen“ . Und wie stehe ich zu den kostenlosen Wochenendblättchen?
Ich habe mich gefragt, ob sie in den letzten Jahren möglicherweise besser geworden sind – so finde ich zuverlässig Artikel über Orte in der nahen und weiteren Region, die ich anschließend besuchen möchte.
Auch ist mir das ein und andere Mal eine Veranstaltung in der Stadt begegnet, die ich sonst verpasst hätte.
Mit diesem sonst so geschmähten Medium hat sich also ein praktischer Nutzen verknüpft. Hatte ich früher einfach keinen Sinn dafür, dass ich all das übersehen habe? War ich früher einfach zu jung dafür – als Antithese zur Frage, ob ich nun stattdessen alt werde? Und wenn dem so wäre: Ist das wöchentliche interessierte Blättern in diesen Wochenendzeitungen dann doch nur eine beruhigende Kombination aus positiv besetztem Älterwerden und dem damit verbundenen weiteren Blick auf Welt und Umwelt?
Wer weiß – ich denke, letztlich ist das alles nicht so wichtig. Schließlich mischt sich bei derlei Überlegungen schnell ein Meinungs-Cocktail aus verschiedenen Instant-Zutaten zusammen, die gemeinsam keinen guten Drink ergeben. Es stehen uns nämlich Vorurteile, Werturteile, Meinungen, Ansichten, Befürchtungen ebenso im Weg wie auf der anderen Seite Wünsche, Ziele, Ambitionen. All das zusammengerührt kann man Ego nennen, und das sehen nicht nur die Buddhisten als nicht objektiv, sogar als schädlich kritisch.
Auch dieses Wochenende habe ich mich also dem Printerzeugnis gewidmet und fühlte mich ganz gut damit.
Womit doch alles gesagt und entschieden ist.