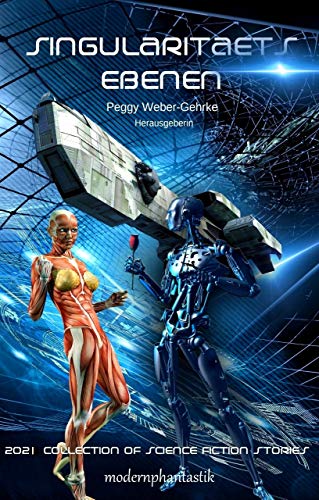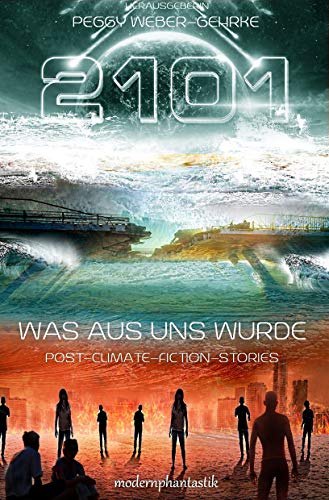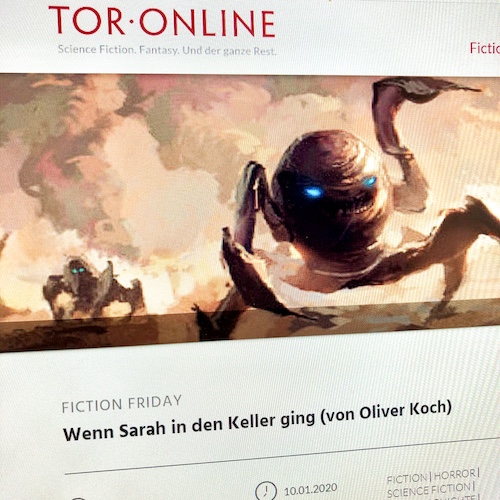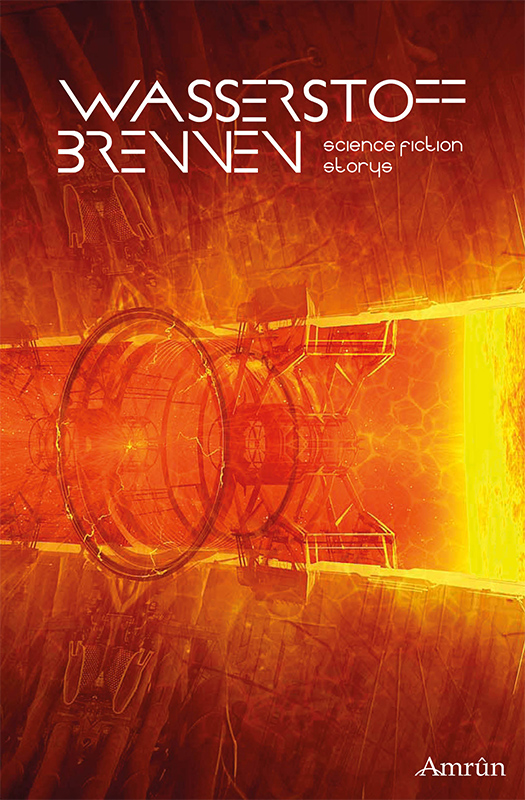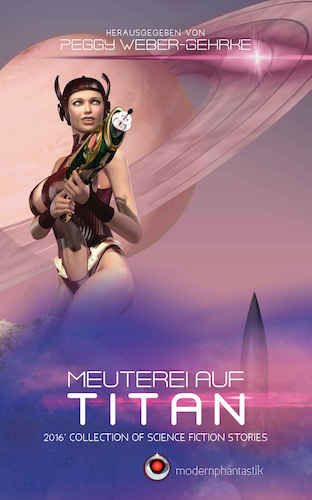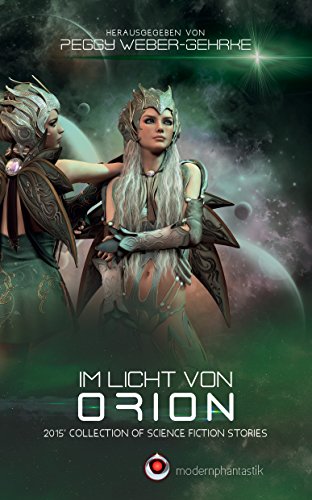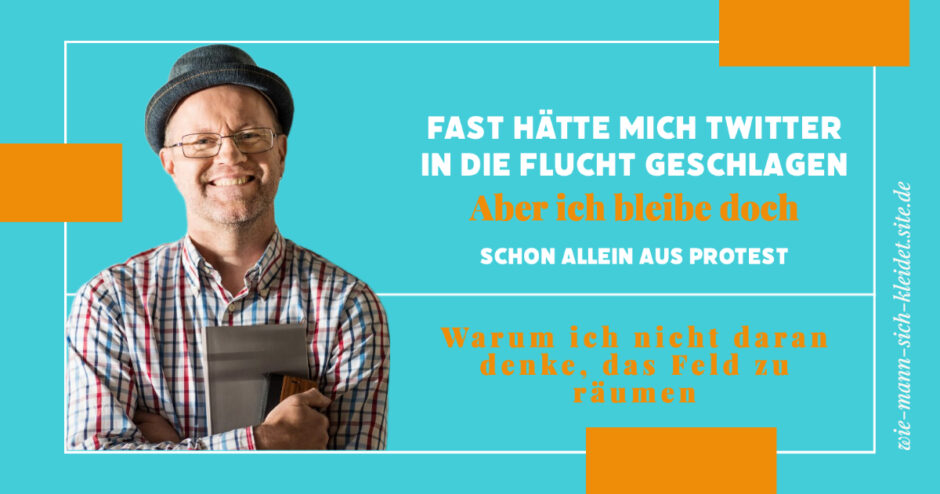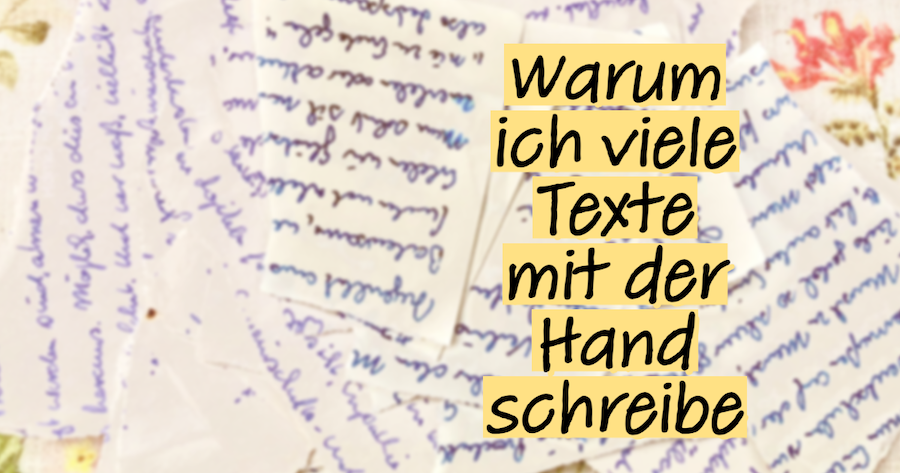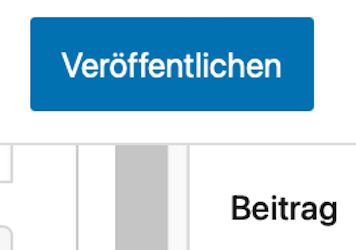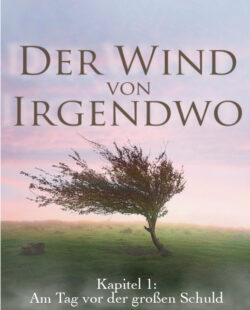Als meine Science-Fiction-Story Bleib bei mir in der Rubrik Futur III der April-Ausgabe 2020 von Spektrum der Wissenschaft erschien, war ich natürlich sehr froh und dankbar. Es war meine erste Magazin-Veröffentlichung überhaupt. Wer die Story lesen wollte, brauchte entweder das gedruckte Heft, die digitale Ausgabe oder einen kostenpflichtigen Zugang zu Spektrum.de.
Das ist inzwischen anders, denn seit einer Weile ist die komplette Story kostenlos und ohne jeden zusätzlichen Account frei lesbar.
Es freut mich, dass meine Story damit allen Interessenten offen steht. Da ich keine eigene, zusätzliche Veröffentlichung direkt im Blog plane, wird meine Story auch exklusiv bei Spektrum der Wissenschaft lesbar sein.
In der Rubrik Futur III veröffentlicht Spektrum der Wissenschaft in jeder monatlichen Ausgabe eine SF-Story – dabei wechseln sich Übersetzungen und Stories deutschsprachiger Autorinnen und Autoren ab. Viele der Stories stehen inzwischen komplett und kostenlos online zur Verfügung. Wer also SF aus Deutschland lesen möchte, wird hier fündig. Und findet auch meine SF-Story.
Science-Fiction-Story Bleib bei mir jetzt lesen.