Mystery-Roman von Oliver Koch
Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesen
Erst Kapitel 2 lesen
Erst Kapitel 3 lesen
Mit der hereinbrechenden Dunkelheit wuchs die Begeisterung der Menschen. Das Fest war nahe, und in der Luft lag der unverkennbare Duft eines vergehenden Tages. Die Sonne stand noch immer heiß im unteren Viertel des Himmels, und man sichtete Lorn, Jessica und Tirata schon von Weitem. Sofort verbreitete sich die Nachricht im Dorf, und alle kamen zusammen, standen beieinander, um Tirata zu begrüßen, wie es sich geziemte. Man atmete die Luft, die mit ihr kam, und respekterfülltes Schweigen machte sich breit. Niemandem wäre aufgefallen, wenn irgendetwas oder irgendjemand in eines der leeren Häuser gegangen wäre.
Einige hundert Augen blickten auf Tirata, und nur auf sie; Lorn war nur Beiwerk, man würde ihn erst loben, wenn das Fest in vollem Gange war. Die Bäume an Tiratas Haus spieen ein sich weit verbreitendes Rauschen aus, das wie ein Flüstern über sie selbst zur wartenden Gemeinde rollte.
Lorns Mund war trocken und sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Gleich würde er einen hochprozentigen Schnaps trinken, und vielleicht sofort noch einen hinterher. Er sah nach vorn und auf Jessica, die in der Mitte der beiden ging, und es behagte ihm nicht, dass seine Tochter allem Anschein nach Feuer gefangen hatte für diese Hexe mit ihrer Magie und ihren merkwürdigen Kräften. Doch allem Verdruss zum Trotz wagte er nicht, etwas dagegen zu unternehmen, denn wahrscheinlich hatte Tirata gerade Jessica verhext, und sein Herz krampfte sich bei dem Gedanken daran zusammen.
Sie kamen schweigend näher, und schweigend wurden sie empfangen. Tirata war es, die das Schweigen brach. »So ist es nun wieder so weit, dass man das Feldfrucht-Fest feiert, und ich soll ein paar Worte dazu sprechen.«
»Deshalb holte ich dich«, meinte Lorn, der sich daraufhin wie ein Held vorkam, zumal jeder mitbekommen hatte, dass er sie freimütig angesprochen hatte.
»Nun«, meinte sie, während Stille in der Luft hing, »das Leben ist hart, aber auch schön. Es ist gut, zu feiern, wenn man Grund dazu hat.«
Niemand wagte, etwas zu sagen, ja, niemand wagte es einmal, auch nur den Blick von ihr zu nehmen. Es war Heiliges, das da aus ihrem Mund kam.
»Ihr habt es euch verdient, und mögen die Augen des Himmels von eurem Fest etwas sehen, das ihr ihnen zu Ehren feiert. Ihr feiert schließlich nicht euch, ihr feiert das Allgegenwärtige, das uns mit dem gleißenden Auge der Sonne am Tag betrachtet und mit dem funkelnden Licht der Nachtaugen in der Dunkelheit. Es ist euer Verdienst, dass ihr so gut leben könnt, denn ihr tut Manches dafür. Aber ohne das Allgegenwärtige, das euch die Möglichkeit dazu gibt, wäret ihr zum Schaffen und zum Leben nicht in der Lage, vergesst das nicht. Vergesst nicht einen Augenblick lang euren Respekt dem Allgegenwärtigen gegenüber. Es ist gnädig und gütig, aber verstimmt es nicht allzu sehr. Dankt ihm. Feiert es. Genießt es. Freut euch.«
Und so konnte das Fest beginnen. Mit dem Schwinden des Tageslichtes begannen die Augen der Nacht über dem Dorf zu leuchten, und der Ozean um sie herum wurde grau und grauer, bis er eine unbestimmbare schwarze Masse war, deren Wellen man nur zu hören ahnte.
Man feierte das Fest, ein großes Feuer brannte in der Mitte des Dorfes und viele kleine darum herum, auf denen gebraten und gekocht wurde. Um sie herum saß und sprach man, trank, sang und spielte Musik, fiel in den Rausch des Alkohols und freute sich, das zu feiern, was man feierte.
Auch Mark und Tsam waren eifrig dabei. Sie aßen und tranken reichlich, wie es üblich war, und langsam wurden sie immer betrunkener. Es machte Spaß zu spüren, wie der Boden unter ihnen zu kreisen begann, wie nichts mehr festzustehen schien, wie sich alles in Gallerte auflöste, und wie man über noch so Verrücktes laut zu lachen begann. Es war ihr erster Rausch, und er kam schneller als erwartet, dafür genossen sie ihn umso mehr. Man ließ sie trinken, man ließ sie lachen.
Mark sah sich um, und alles um ihn herum flackerte in merkwürdigem Scheine der vielen Feuer. Andere hatten sich zu ihnen gesellt, auch Sarah, die ihn ansah und sich still verhielt.
Irgendwann sah er sie. Sie saß im Schneidersitz auf dem Boden, und ihre Haare trug sie offen. Sie war ein wahrhaft schönes Mädchen, das erkannte er nun. Und nicht nur das.
Wieder regte sich etwas in ihm, das er nicht zu deuten verstand, vor dem er sich gar fürchtete, aber gegen das er sich nie hatte wehren können – und nun schon gar nicht.
Er sah sie an, wie sie in einigen Metern Entfernung von ihm saß, umgeben vom flackernden, gelblichen Schein, und ihre Haut machte nie geahnten Eindruck auf ihn, und in ihren Augen lag etwas Merkwürdiges, das er nicht verstand. Aber so hatte sie ihn noch nie angesehen, und er spürte, wie eine Macht in ihm aufwallte und ihn ergriff.
Tsam stieß ihn an. »He, die Kinder wollen Maraim nun seine Abreibung geben. Komm mit.«
Teilnahmslos fragte er nur: »Was?«
»Hast du mir nicht zugehört?«
Wie es in ihm pumpte und schlug, und er begann zu begreifen, warum es stets hieß, dass Männer und Frauen zusammengehörten, auch wenn er nicht leugnete, mit Tsam genauso leben zu können.
Mark sah Sarah an, die ihn nicht losließ mit ihrem Blick, und er verspürte die Lust, zu ihr zu gehen, sich neben sie zu setzen, einen Arm um sie zu legen, sie zu küssen, sie … was eigentlich? Was sollte er mit ihr machen? Was wollte er von ihr? Er war nicht so dumm, dass er nicht wusste, was zu tun war, aber er konnte es sich einfach nicht vorstellen, es selbst zu tun, auch wenn sein Körper nun danach verlangte. Nur, wie sollte er es anstellen?
»Mark! Du hast es vorgeschlagen! Jetzt komm auch mit!«
Er sah zu Tsam auf, der ungeduldig neben ihm stand. »Ich weiß schon, was mit dir ist«, meinte dieser ziemlich vorwurfsvoll. »Ich kenne das. Aber Sarah?«
»Warum nicht?«
»Helena ist viel, nun …«
»Helena? Versuch doch, an sie heranzukommen.«
Tsam grinste. »Das war natürlich auch ein Grund, weswegen ich mich auf heute gefreut habe. Komm schon. Erst Maraim, dann das Andere.«
So gingen sie.
In der guten Stimmung, bei der Musik, die in der Luft hing, dem Lachen und den Gesprächen war es ein Leichtes, die Kinder des Dorfes zu sammeln. Mit andauerndem Kichern holte man Eimer und Schüsseln, in denen es glibberte.
Das Dorf war eine flackernde und sich bewegende Masse. Die Häuser schienen zu zucken und unregelmäßig zu tanzen, Feuergeruch und Hitze lagen in der Luft, und im Schutz der Schatten und der Dunkelheit bereitete man sich auf den größten Streich vor, den man jemals im Dorf gesehen hatte.
Maraim saß unbeachtet und gemieden an einem Feuer, um ihn herum tobte das Fest, ohne dass er es recht mitbekam.
Niemand sprach mit ihm, niemand war interessiert an ihm, jeder hatte irgendeine Abneigung gegen ihn. Wäre er nicht so abscheulich gewesen, hätte er das Fest wohl schöner verleben können. Da er aber jedem seiner Art und Weise wegen ein Gräuel war, war er der Pol des Schweigens in einem bunten, redenden, und johlenden Haufen, der sich im seltsamen Licht und Schatten der Feuer amüsierte und trank allein. Mittlerweile völlig im Rausch, nahm er das Meiste nicht mehr wahr, was um ihn herum geschah; und hätte sich jemand mit ihm unterhalten, wäre allen aufgefallen, wie verletzlich Maraim war, wenn er sich allein betrank. Zu einem Gespräch war es noch nie gekommen, meistens war er unverschämt und wies alle von sich, um etwas Dunkles in ihm zu verschleiern, das er mit niemandem teilen konnte und teilen wollte, auch, weil ihm die Begriffe fehlten für das, was in ihm vorging.
Ohne es zu wissen und ohne dass die Erwachsenen es wussten, war er bei den Kindern die Hauptperson des Abends – und wäre der Grund dazu nicht so ein finster gewesen, hätte sich Maraim das erste Mal rühmen können, bei einigen Personen im Mittelpunkt zu stehen.
Die Kinder, unter ihnen auch Mark und Tsam, waren im Licht zuckende Tentakel, die sich überallhin ausbreiteten, wohlkoordiniert und Maraim umschließend, um möglichst von allen Seiten an ihn heranzukommen. Niemandem fiel auf, dass die lachenden Kinder Eimer und Schüsseln trugen.
Nichtsahnend vergaß er alles um sich herum und war nicht einmal mehr dazu in der Lage, seine Nachbarn auszumachen, die einige Meter von ihm entfernt das Fest feierten.
Die Kinder schlichen kichernd auf ihn zu, von fast allen Seiten, und sie lachten teils laut, um kurz darauf einen erstickten Laut von sich zu geben, wenn sie sich das Lachen abzuschnüren versuchten. Sie sahen Maraim sitzen.
Sein massiger Oberkörper war zusammengesunken, seine Augen waren triefend, seine Haare fettig, seine Beine lagen wie nicht zu ihm gehörig leicht gegrätscht vor ihm, und alles in allem machte er den Eindruck einer dicken, tranigen Kröte.
Jessica juckte es im Magen, so nervös und belustigt war sie. Sie konnte es gar nicht abwarten, bis Maraim unter all dem Schlamm und Glibber sowie Froschlaich verschwand. Auch hatten sie Kuhmist gesammelt. Mark sah sich um und gab Handzeichen. Sie alle waren nur noch ein paar Meter von Maraim entfernt, und auf Marks Wink hin begannen sie zu laufen, kreisten ihn ein und entleerten mit Schwung ihre Eimer und Schüsseln. Schlamm, Laich und Kot trafen ihn ins Gesicht und auf die Brust, faserige, glitschige Pflanzen benetzten ihn, und die Kinder schrien laut vor Vergnügen.
»Hier hast du das, woraus du kommst, du Kröte!« schrie Tsam, dass sich seine Stimme überschlug, und Maraim, dem der Schlamm vom Gesicht troff, schrie aus Ekel und Schreck. Er war nass, kalt und glitschig, und einige gefangene Frösche sprangen und quakten um ihn herum. Er konnte nur dasitzen, von Ekel und Schrecken zusammengezogen und brüllen, und die Kinder liefen um ihn herum und riefen und sangen: »Maraim, die alte Kröte! Maraim, die alte Kröte!«
Die Umsitzenden und Umstehenden stimmten ein gemeinsames Lachen an, sie lachten und schrien vor Vergnügen, sie zeigten mit Fingern auf ihn und machten ihn zum Mittelpunkt des Hohns und der Schadenfreude. Sie kamen heran, um Maraim auszulachen, denn es gab niemanden im Dorf, der ihm diese Behandlung nicht von Herzen gönnte. Das hatte er nun von seiner an den Tag gelegten Abscheulichkeit, die er jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellte. Im Dorf, in dem jeder am Leben arbeitete und jeder zugleich auch das Leben der anderen lebte, mithalf und unterstützte, war er das Geschwür, das sich diesen Streich wahrhaftig verdient hatte. Und nun lachte man über ihn und lobte die Kinder, die um ihn herumtanzten und noch immer sangen: »Maraim, die alte Kröte!«
Maraim selbst war außer sich. Er war erschrocken, angeekelt – und allein. Er schrie allen Zorn aus sich heraus, ohne mehr tun zu können, als nach einigen Sekunden damit zu beginnen, sich Schlamm, Kot und Laich aus seinem Gesicht zu wischen. Dabei konnte er bei der Menge nicht verhindern, dass ein wenig davon in seinen Mund kam. Schlamm rutschte in sein Hemd, in seine Hose, überallhin. Schließlich sprang er auf und weinte lauthals. Es hörte sich an wie der Schrei eines Bullen, der sich die Beine gebrochen hatte und nun auf der Weide lag. Es ging im Lachen der Leute und im Singen der Kinder unter. Er war die Hauptperson des Moments, ohne ihn zu fragen.
Er lief fort. Man sprach von ihm als rennende Schleimkröte. Die Feuer tätowierten den Lachenden und Vergnügten Masken der Schadenfreude und des Hohnes in die Gesichter, und sie ließen Maraim laufen, der panisch vor allem davonlief, hinein in die Dunkelheit, hinein in das, was von den Menschen des Dorfs um diese Zeit zumeist gemieden wurde: die Nacht.
Mark und Tsam waren stolz auf sich. Sie lachten und konnten einfach nicht aufhören. Um sie herum tobte eine Schar Kinder, die die Soprane eines donnernden Tutti darstellten, das alle vor Lachen von sich gaben.
Derlei hatte es im Dorf noch nie gegeben, und wenn, dann lag es so weit zurück, dass keiner der Lebenden dabei gewesen war. Und überliefert war auch nichts.
Dafür hatten Mark und Tsam und alle anderen Kinder etwas getan, das überliefert werden sollte. Es gab keinen richtigen Ausdruck dafür im Dorf, und so war das Getane nur eine herzerfrischende Abreibung.
Die kleinen Kinder tanzten und hüpften um Mark und Tsam herum, und diese beiden hielten sich laut lachend in den Armen. »Wir haben uns verewigt«, meinte Tsam stolz, und sie ließen sich etwas ferner eines der Feuer nieder. Hier war es nicht voll, die Erwachsenen waren alle nahe der Feuer, und die Kinder rannten vergnügt wieder zu ihnen, um sich loben zu lassen für ihre Tat.
Die Einzige, die bei den beiden blieb, war Sarah. Sie stand vor ihnen und sah Mark abermals auf diese wundersame Weise an, und Mark konnte sich dem Blick nicht entziehen. »Das war großartig«, sagte sie. Sie wollte sich wohl nicht setzen, und so sah sie auf ihn herab. Die Feuer, die hierher nur einen diffusen, flackernden Schein von der Schwäche eines fernen Sterns trugen, zeichneten in ihr Gesicht einen fremden, unnatürlichen Eindruck. Ihre langen, gekämmten Haare waren eine dunkelgraue Masse, und die Schatten auf ihren Zügen waren tief. Was war es nur, was in ihnen lag?
Eigentlich hatte Mark ihr entgegnen wollen, wie sehr es ihn freute, dass es ihr gefallen hatte, doch die Luft schien ihm das Sprechen verbieten zu wollen. Er saß nur da und sah zu ihr auf. Ihr Kleid war luftig und leicht, und das erste Mal wollte Mark die Silhouette ihres Körper unter dem Kleid bemerken, ein Umstand, der ihn einerseits befremdete und andererseits anregte. Mit einem Mal wurde die Nacht, die er sonst höchstens aus jugendlichem Übermut nicht hatte meiden wollen, zu etwas Wundervollem, wurden die Schwärze und die Undurchsichtigkeit zu etwas Idealem. Die Corrin-Höhle, dachte er sich, ohne sich dessen bewusst zu werden, musste reizvoll sein in all ihrer Unergründlichkeit. Tief in ihr zu sein, wo das Innerste lebte und bebte, wo das Geheimnis schlummerte, das überall um sie herum war und das an ihm nagte – dort hatte es Ursprung und Erfüllung.
Die Nacht machte unsichtbar, sie löschte Existenzen aus, wie die Corrin-Höhle mit allem, was dazugehörte. Und Tirata – mochte sie sagen, was sie wollte. Wo der Drang ist, zu erkunden, kann kein Weg zu steil, zu stachelig und zu tief und zu gefährlich sein.
Er erschrak ein wenig, als er bemerkte, dass Tsam nicht mehr bei ihnen war; jedoch sah er sich nicht einmal um. Tsam war fort, und das war wohl ganz gut so. Er widmete sich ganz Sarahs Gesicht und dem merkwürdigen Ausdruck darin, den leicht orangenen, gesunden, fleischlichen Schein, den sie zur Schau trug.
Und als er sie das erste Mal berührte und küsste und ihre Haut spürte, dachte er an die Tiefe und Fremde der Corrin-Höhle, ohne auf den Gedanken zu kommen, wirklich ihr Geheimnis lüften zu wollen.
Beschmutzt und elend rannte Maraim wie von Sinnen vom Fest fort und von all den Menschen, die dabei waren und die ihm so Böses angetan hatten. Man schien ihn nicht mehr dulden zu wollen. Hinzu kam sein Rausch, der ihn ins Trudeln versetzte und nur noch mehr seine Wut und Traurigkeit anstachelte. Maraim war nicht fähig zu erfassen, weswegen man ihm seine Behandlung gegönnt hatte, und das lag nicht nur am Alkohol. Auch im nüchternen Zustand war er nicht fähig dazu. Er besaß weder Takt noch Anstand, aber auch nicht das geistige Potential, das zu erfassen. Das brachte ihn in eine einmalige, schlechte Situation. Er weinte, heulte, holte geräuschvoll Luft, und in ihm pumpte es dermaßen, dass er nichts anderes tun konnte, als zu laufen wie ein Mann von Sinnen. Mittlerweile hatte er schon vergessen, wo er war, und das war ihm auch völlig gleichgültig, er wollte nur fort, fort, und sein Rausch ließ ihn alles vergessen. Für ihn war die Nacht ein schwarzer Tunnel, und alles, was in ihm war, schoss an ihm vorbei, ohne sich in sein Gedächtnis einzubrennen.
Irgendwann brannte ein Feuer in ihm, er bekam keine Luft mehr. Seine Lunge schmerzte, und Übelkeit überkam ihn. Nichts war hier vom Fest zu hören und zu sehen, er musste weit gelaufen sein. Vor ihm türmte sich ein bedrohlicher, kaum sichtbarer schwarzer Riese auf, es waren die Berge, vor denen er stand. Die Nacht war so unheimlich schwarz und undurchsichtig, dass es Maraim geschockt hätte und vor Furcht hätte vergehen lassen, wenn er sich ihrer bewusst geworden wäre. Auch wäre ihm dann aufgefallen, dass er sehr nah an die Berge gelaufen war, ein enorm weites Stück, und für nachts schon eine an Wahnsinn grenzende Entfernung.
Maraim keuchte und weinte alles aus sich heraus. Er spürte nicht, wenn er sich in Dornen verfing, die ihm Kleidung und Haut zerrissen, er hörte das Knacken der Äste nicht, wenn er sie zertrat, er nahm kaum wahr, dass er hin und wieder Bäume rammte. Brechreiz stieg in ihm auf, er würgte, und die säuerliche Masse spülte schon in seiner Kehle, er röchelte nach Luft, doch er lief dessen ungeachtet weiter, als plötzlich gegen etwas stieß, er verlor das Gleichgewicht, fiel zu Boden wie ein kippender Baum, und als er aufkam, kam es einem Hammerschlag gleich. Sein Kopf wollte explodieren, es gab einen Knall, als sein Schädel zerbarst und Blut spritzte in die Nacht auf den Stein, auf den er gefallen war mitsamt seinem beachtlichen Gewicht.
Als Maraim den furchtbaren Schlag spürte, riss er die Augen auf und rollte ein wenig zur Seite, Dornen bohrten sich in sein Fleisch wie tausend kleine Nadeln, und er sah in den letzten Augenblicken seines Lebens die Sterne in der Unendlichkeit des Alls, und er strebte zu ihnen, bevor die Finsternis Arme ausstreckte, die ihn auffingen, bevor sich die Nacht über ihn legte wie ein Totentuch und er in wohligen, ewigen Schlaf sank.


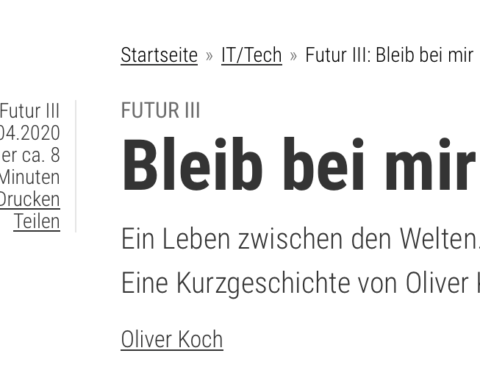







[…] 1: Am Tag vor einer großen SchuldKapitel 2: Der Streich Kapitel 3: Bei TirataKapitel 4: Maraim und die FröscheKapitel 5: Die Last der SchuldKapitel 6: Der Himmel weintKapitel 7: Ein neuer TagKapitel 8: Jessica […]
Fressen, saufen, sterben?
In diesem Kapitel geht alles ganz festlich zu, so, wie man es gern auf einem kleinen Dorf-Fest haben will. Nette reden werden geschwungen, es wird gegessen, getrunken und getanzt.
Nur der arme Mariam amüsiert sich nicht so sehr. Er ist ja auch mit fast allem überfordert, was seine aggressive Art um so besser erklärt.
Was passiert, nachdem die Kinder des Dorfes ihm eine Abreibung verpassen, müsst ihr selbst lesen.
Ich hätte diese Wendung nicht erwartet.
Das mit dem Hobbit-Dorf nehme ich schon mal zurück.
[…] Wind von Irgendwo“ geht weiter mit Kapitel 4: Maraim und die Frösche am Sonntag, 10. April […]
[…] Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesenErst Kapitel 4 lesen […]