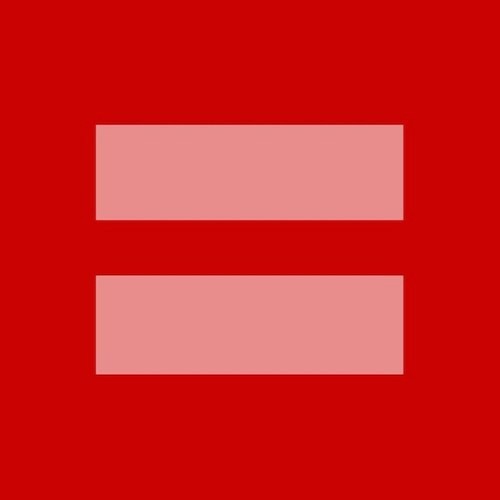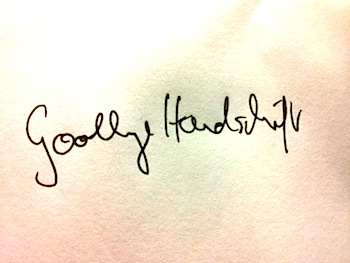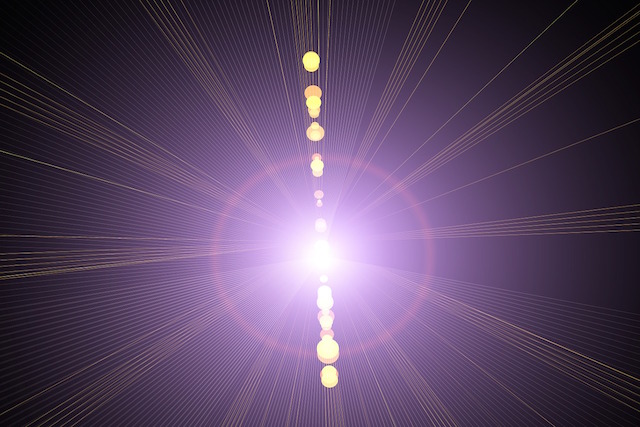Als vor 22 Jahren die Dinosaurier erstmals realistisch auf der Kinoleinwand zu sehen waren, sprach jeder von Steven Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park. Heute sieht zwar scheinbar jeder Jurassic World, mit dem die Reihe nun nach vielen Jahren recht solide weitererzählt wird – doch ich vermisse etwas.
Ja, wir staunten alle mit offenen Mündern im Kino, damals 1993. Da war von Spielbergs neuem Film schon weit im Vorfeld die Rede, weil man von einer digitalen Innovation sprach, die Effekte erschaffen sollten, wie man sie bis dato noch nicht gesehen hatte. Schon zwei Jahre zuvor hatten wir mit Terminator 2 eine Trickeffekt-Fahrt gesehen, die gar kühnste Vorstellungskraft sprengte – wenn nun ausgerechnet Spielberg einen nie gekannten Realismus von Effekten ankündigte, konnte man gespannt sein. Und das waren wir. Auch, weil die Romanvorlage seit Jahren ein Bestseller war und die Frage kursierte: „Wie wollen die das denn bloß verfilmen?“ Trotz aller Hoffnungen, Spielberg werde es schon hinbekommen, gab es da auch die Zweifel in das, was Kino und Effekte abbilden können, zumindest glaubhaft.
Als wir dann im Kino saßen, war das unbeschreiblich. Wir sahen, was wir noch nie zuvor gesehen hatten. Wir sahen auch, was wir uns nie zuvor vorstellen konnten, jemals zu sehen – eine Überwältigung, die ihre Spuren in der Kinogeschichte hinterlassen hat.
Als Technik die Erzählung sprengte
In den 90er-Jahren war das noch aufregend: Da sahen wir plötzlich ganz neue Dinge – und damit auch neue Erzählungen. Geschichten emanzipierten sich dank neuer Tricktechnik, die alles zeigen konnte, aus dem Korsett des Darstellbaren. Nun konnte man Geschichten erzählen, die man vorher nie hatte erzählen können. Denken wir an Twister, Independance Day, Titanic, und nicht zu vergessen Anfang des Jahrtausends die Herr-der-Ringe-Trilogie. Die Technik vollbrachte mit dem Wunder neuer Bilder auch das Wunder neuer Erzählungen. Das war großartig.
Die digitale Ermüdung heute
Inzwischen ist all das abgenutzt. Es gibt einfach nichts mehr, was wir nicht schon gesehen haben, digitale Tricktechnik macht’s möglich.
Wie viel Rechnerleistung in Spider-Man-Filmen steckt oder im Hobbit, ist nur noch eine technische Angabe, die keinerlei Anteil mehr an neuen Geschichten trägt. Vielmehr gehen in erstaunlich vielen Filmen erstaunlich viele Städte unter, möglichst viele Trümmer und immer noch mehr Trümmer. Transformers 3, Transformers 4, Avengers 2, Man of Steel: Hier müssen es gleich ganze Städte sein, die untergehen. Abgesehen davon, dass es zwar grafisch hochaufgelöst ist, haben diese unzähligen, überteuren Effektorgien noch immer eben die Künstlichkeit, die Distanz bringen zwischen dem Zuschauer und der Erzählung. Wir wissen nicht nur, dass von all dem kaum etwas echt ist – wir sehen es auch immer noch.
In Katastrophenfilmen der 70er-Jahre gab es Story und Dramaturgie. Der Terror einer Katastrophe war spürbar.
Und heute? Da fliegen und krachen die Pixel. Hochaufgelöst, quietschbunt. Wie bereits in dem Film davor. Und dem davor. Und dem davor. Neues bietet sich uns nichts mehr, nicht einmal mehr eine technische Innovation. Im Gegenteil: Ich werde das Gefühl nicht los, dass mit der Einführung von 3D 2009 nun alles verschossen wurde.
Es ermüdet nunmehr, dass es keine neuen maßgeblichen Bildtechniken und auch Erzählformen mehr entstehen, sondern wir in einer Endloschleife des Ewiggleichen und Schonlängstgesehenen gefangen sind.
Alles digital, schon hundertmal gesehen
Die unsägliche Trümmerflut der überzüchteten Hollywood-Blockbuster-Maschine ist nur noch langweilig und meist narrativ dumm. Nicht einmal mehr noch größer können die Schlachten und Final-Spektakel mehr sein. Transformers 3 gipfelte schon vor Jahren in einer über 45-minüten Trümmerorgie, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Zack Snyders augeblasener Man of Steel ließ die übertriebenste Finalschlacht aller Zeiten auf uns Zuschauer los. Der 3. Teil der Hobbit-Trilogie artete in grobmotorisches, grauenhaft schlecht erzähltes Getümmel ohne Story, Spannung, Sinn und Seele aus – und selbst die so gelungenen Avengers gaben uns im 2. Teil nicht viel mehr als schon tausendfach abgenudeltes, ausgeleiertes, kurz: Höchst langweiliges, uninspiriertes Gekloppe.
Das Staunen und das Ansehen
Das bringt mich zurück zu Jurassic World.
Ich sitze da, ich war 1993 von Jurassic Park überwältigt wie alle. Ja, wir hatten so etwas noch nicht gesehen.
Bei Jurassic World ist das nicht so. Wir werden ganz sicher alles schon einmal irgendwie irgendwo schon mal gesehen haben. Und richtig: Wo Jurassic Park 1993 Überwältungskino de luxe war, ist Jurassic World 2015 nichts weiter als einfache Unterhaltung.
Jurassic Park brachte uns 1993 das Staunen.
Jurassic World bringt uns 2015 einfach nur bessere digitale Dinos als damals.
Jurassic Park startete vor 22 Jahren in einer Zeit, da die Filme in den USA im Sommer anliefen und im Rest der Welt im Herbst. Filme hatten Wochen, teilweise gar Monate Zeit, einen Hype zu entwickeln, der dann nach und nach mit Verzögerung die anderen Länder erreichte.
Von Jurassic Park las ich im Sommer 1993 in der Tageszeitung die Headline „Die Dinos brechen alle Rekorde“. Da wusste man, Spielberg hat es geschafft. Und wir würden wirklich etwas zu sehen bekommen, das man so noch nicht gesehen hatte.
Heute starten die Filme weltweit nahezu zeitgleich. So kam Jurassic World ganz anders als sein großes Vorbild einfach in die Kinos. Was einst ein Werk war, ist heute Produkt, das zur Vermeidung der illegalen Raubkopien im Netz möglichst breit startet, damit die Einnahmen maximiert werden können.
Der vermisste Moment
Nun saß ich in Jurassic World und er gefiel mir. Aber wenn ich ehrlich bin, liegt das auch zum großen Teil daran, dass er die Geschichte von vor 22 Jahren geschickt aufgreift, weitererzählt und damit in seine eigene Erzählung integriert. Da man mich in Jurassic World immer wieder an Jurassic Park erinnert, erinnere ich mich auch an die Wirkung des Originals vor 22 Jahren – die letztlich auf den neuen Film abfärbt.
Natürlich ist das richtig, notwendig, vernünftig und überdies geschickt gemacht. Aber wären die Dinos heute genauso erfolgreich wie ohne das Original?
Spielbergs Film ist Legende. Alles danach profitiert von ihr.
1992 saß ich im Kino die Auflösung der Grenze zwischen Realität und Spezialeffekt. Heute im hochauflösenden Zeitalter sind neben den Gewöhnungseffekten die Tricks oft nicht überzeugend genug, um nicht künstlich zu wirken.
Deshalb: Ja, ich vermisse etwas. Das Besondere. Das Einzigartige. Den Kinomoment, der prägt und den ich mitnehme. Bilder, die ich nie vergesse, wie ich auch ihre Wirkung auf mich nie vergesse.
Man kann es auch Magie nennen. Das ist den meisten Filmschaffenden in der Blockbuster-Industrie (die sich übrigens markant von der übrigen Filmindustrie unterscheidet) inzwischen ein Fremdwort. Ob nun unfähige Regisseure, schlechte Drehbücher, omnipotente Produzenten, gegen die sich Kreative nicht durchsetzen können: Sie arbeiten nur noch selten an Geschichten, die Tricktechnik erfordert – Cameron ist so einer – sondern an Produkten und im schlimmsten Fall an Franchises.
Nein. Das macht mir keinen Spaß.