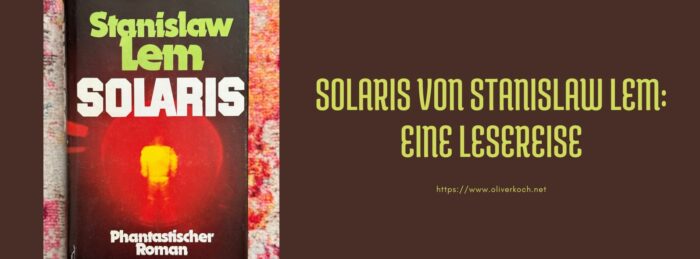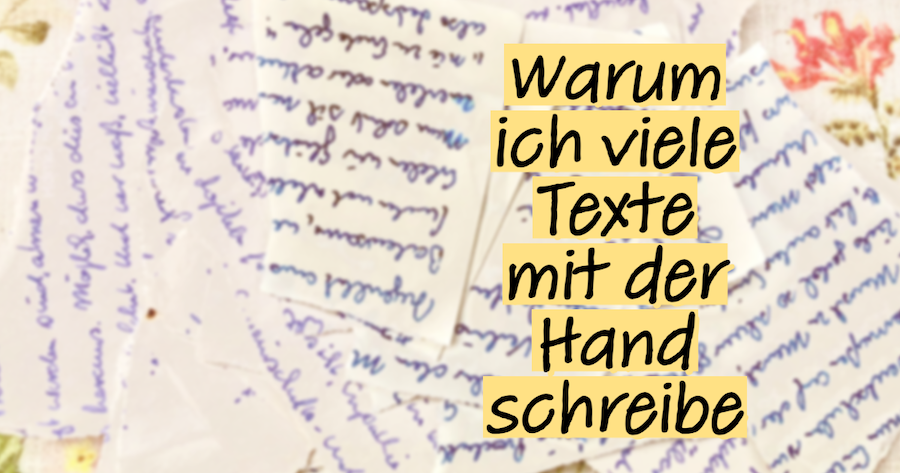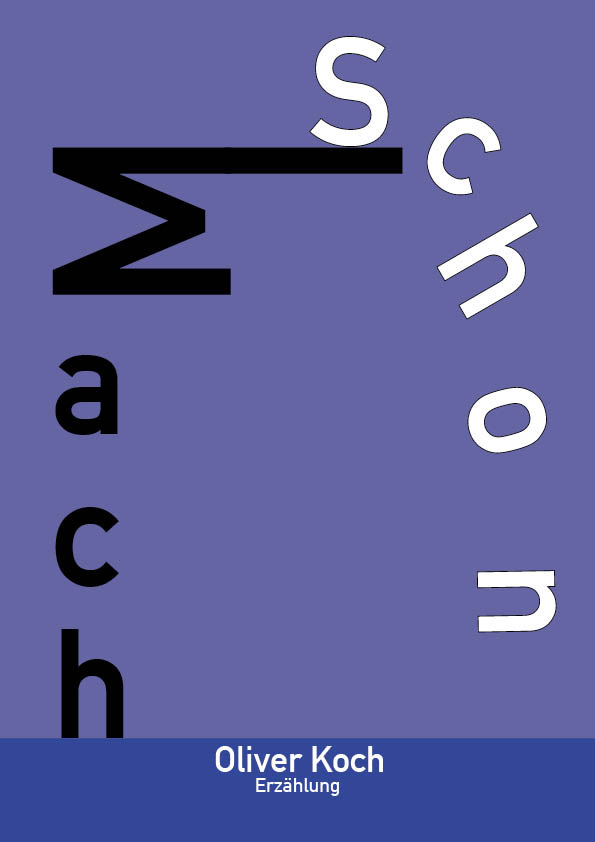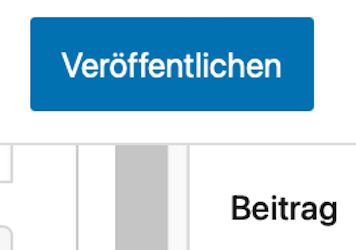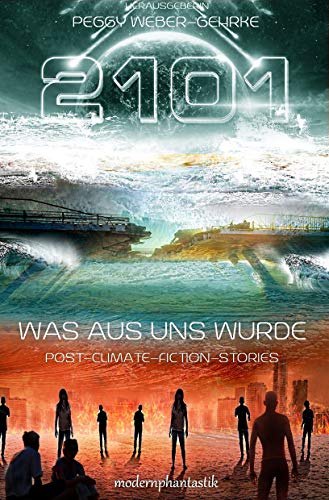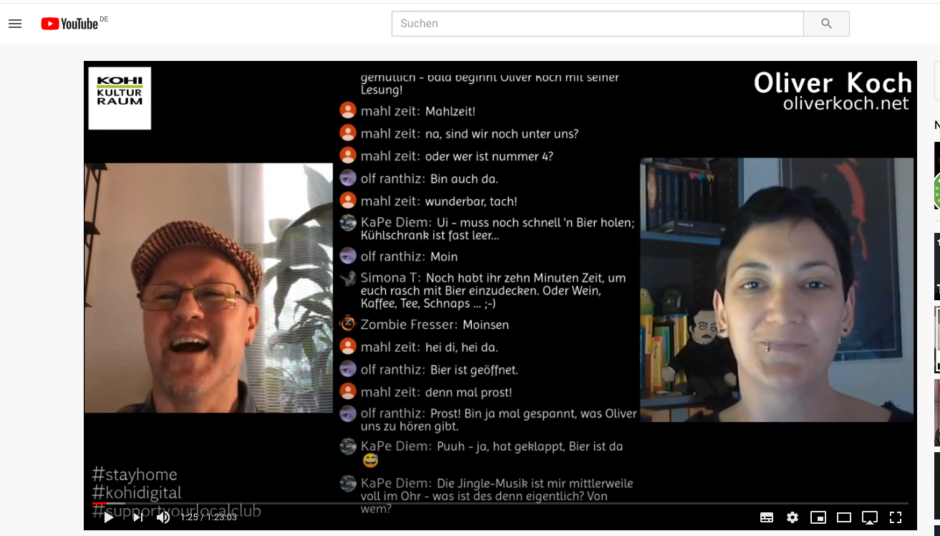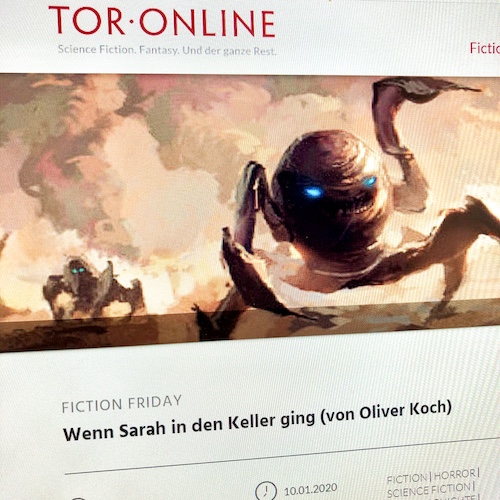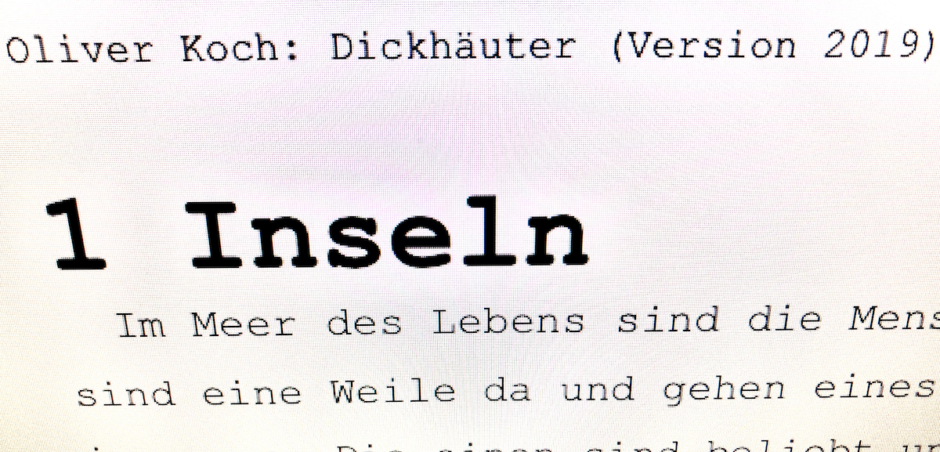Woher ich diese eigentümliche Ausgabe von Solarisvon Stanislaw Lem habe, entzieht sich meiner Kenntnis. Ebenso, seit wann ich sie besitze. Fest steht nur: Es sind Jahrzehnte, ich ging noch zur Schule. Damals habe ich mich erstmals an dem Roman versucht und bin gescheitert. Das war auch bei den folgenden Anläufen so. Erst jetzt, 2025, habe ich es geschafft.
Eine Sprache, die knarzt und knackt
Doch auch dieses Mal wäre ich fast an den Klippen des Romans gescheitert. Denn es stimmt ja: Lems Sprache in Solaris ist knochig, die knarzt und knackt, unzeitgemäß, doch Achtung: Kann es das eigentlich geben, Unzeitgemäßheit? Schließlich ist ein Roman Kind seiner Zeit.
Dass Vieles von dem, was Lem da technisch schreibt und beschreibt, hoffnungslos veraltet ist, liegt bei einem Roman von 1959/60 auf der Hand. Aus heutiger Sicht ist es dennoch erstaunlich, wie extrem Lem seiner eigenen Zeit auch auf den Leim ging. Computer kommen gar nicht vor, dabei war das Konzept schon längst vorhanden. Es gibt Bibliotheken mit schweren, alten Büchern, Folianten gar – gleichzeitig aber auch Bände auf Mikrofilm. Beides mag nicht zusammenpassen, zumal die völlige Abwesenheit von Datenverarbeitung mir unerklärlich ist.
Aber zurück zur Sprache. Lems Werke zeichnen sich bekanntlich durch hohe Wissenschaftlichkeit aus. Fand ich deshalb auch dieses Mal den Einstieg so zäh und unzugänglich, dass ich erneut mit dem Gedanken spielte, ihn abermals und diesmal zum allerletzten Mal, entnervt zuzuklappen?
Ein Schreibstil, der es lohnt, ihn zu pflegen
Die Dinge liegen anders. Es stimmt, durch Lems Wissenschaftlichkeit und Analytik eignen sich seine Werke nicht als klassische Pageturner. Ich hatte jedoch verlernt, mich auf diese Art von Sprache und Erzählung einzulassen, was verwundert, liebe ich doch langsame Geschichten sehr. Zumal es In Solaris schon recht früh interessant wird, Lem schreibt es nur nicht spannend – oder?
Ich musste erkennen, dass ich mich von einem Schreibstil entfernt habe, der sich lohnt, ihn zu pflegen. Denn was Lem in Solaris alles schreibt und beschreibt, ist ganz großes Kino; so groß, dass der Roman bislang dreimal verfilmt wurde: 1968 für das russische TV, 1972 als russischer Kinofilm, von Andrei Tarkowski, der zum Klassiker wurde, 2002 dann in den USA von Steven Soderbergh als teures Vehikel des damals noch aufstrebenden Stars George Clooney. Der US-Film wurde und wird gehasst, Lem selbst konnte ihn nicht bis zum Ende ansehen, auch mit den russischen Verfilmungen war er nie zufrieden, was doch zeigt: Lem hat mit Solaris etwas Einmaliges geschaffen – nur in Stil und Sprache auf eine Weise, die bisweilen Gewöhnung erfordern mag.
Da schwingt etwas
Dass ich durchgehalten habe, war auf jeden Fall eine hervorragende Entscheidung, denn dann klappte es, ich war „drin“, es hatte mich gepackt, und ich konnte und wollte den Roman gar nicht mehr aus der Hand legen. In der Erzählung schwingt etwas, vibriert etwas, da ist ein Grundton, der fesselt und den Geist anregt. Solaris ist ein überaus faszinierender Roman, er ist sogar ein ganz großartiger Roman. Es gab Stellen, die ich in diesem alten Schmöker sogar mit Bleistift markiert habe, um sie mir zu merken.
Was mich an dieser meiner alten Ausgabe stört: Abgesehen von dem wirklich billig aussehenden Cover ist es ein billiger Druck der 80er-Jahre. Dickes Papier wie Pappe, der Druck wird ab der zweiten Hälfte teilweise sogar leicht schräg, sodass die Schrift in leichte Schieflage gerät, dann natürlich der Gebrauch der alten deutschen Rechtschreibung, dass ich ständig zusammenzucke, wenn ich Schreibweisen lese, die es schon lange nicht mehr gibt (glücklicherweise, möchte icg bei vielen hinzufügen), aber vor allem sind es auch die Fehler. Da lese ich, dass etwas „war“ sei statt „wahr“, immer wieder fehlen Kommas, die sowohl in alter als auch in neuer Rechtschreibung zwingend waren und sind.
Ich habe nachgesehen: Bei der noch heute maßgeblichen Übersetzung von Imtraud Zimmermann-Göllheim wurde laut der Ausgabe des Ullstein Verlags von 2021 hinsichtlich Orthografie und Interpunktion „behutsam modernisiert“ – richtig so. Die Sprache bleibt weiterhin zu recht so altmodisch und liegt wie ein Relikt aus einer vergangen Sprachzeit da, und das ist faszinierend. Aber so oder so: Solaris hat meine Sicht und mein Denken erweitert. Über einige Dinge denke ich noch eine Weile nach, es gibt auch Bilder in diesem Roman, die für mich nun unauslöschlich sind. Ob man Solaris noch einmal verfilmen sollte? Unbedingt! Aber nur, wenn man genug Respekt vor dem Roman hat, um wirklich ihn und seine Aussage zu verfilmen. Freiheiten sollten nur bei der Aktualisierung der Technologie erlaubt sein, ansonsten eignet sich das Buch famos, genau so verfilmt zu werden, wie es geschrieben steht.
Dass ich erst jetzt, mit über 50 so weit war, Solaris zu Ende zu lesen, sollte ich nicht schade finden. Buch und Leser finden sich oder sie finden sich nicht. Der Zeitpunkt spielt dabei eine entscheidende Rolle. Nun hat es gepasst. Ja, endlich, und ja, glücklicherweise. Ein enormes Buch, das ich mir möglicherweise noch einmal in einer Neuausgabe besorgen werde.