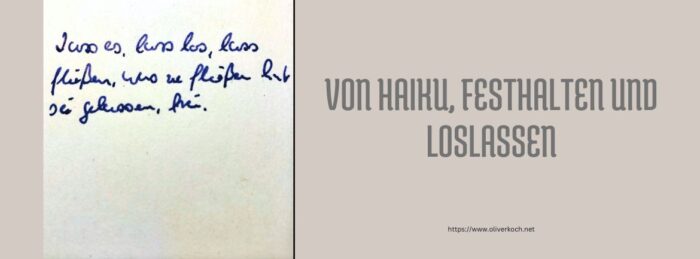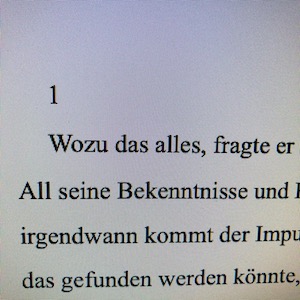Kürzlich suchte ich zum Testen eines mobilen Druckers ein Foto auf meinem Smartphone.
Es traf mich wie der Schlag: Ich fand nur mit Mühe eines, das den Ausdruck wert war. Wozu, frage ich mich nun, habe ich all die anderen Fotos gemacht, wenn sie allesamt nicht gut genug waren, gedruckt zu werden?
Abgesehen von meinen fotografischen Fertigkeiten: Was sind all diese gemachten Fotos, die mein Smartphone bevölkern? Was war ist Sinn? Und haben sie noch immer einen Sinn?
Reine Information, sonst nichts
Die Sache ist klar: All diese Fotos sind keine Fotos an sich, keine bildlich eingefangenen Motive – sie sind reine Information und sonst nichts. Ich habe sie gemacht, um einen Post in sozialen Netzwerken zu bebildern, damit man sehen konnte, worüber ich schrieb. Sie dienen als Bestandteil einer Beitragsgrafik im Blog. Ich hatte sie gemacht, um sie an andere Personen zu schicken – nicht als Foto, sondern als eine reine Information: Das da meine ich. Schau mal. Ich wollte damit erreichen, dass sich andere ein Bild von etwas machen konnten, worüber ich sprach.
Diese Fotos sind fast wie Untertitel zu einer Nachricht.
So hatte ich meine Fotos noch nie gesehen: Ob sie auch als Foto selbst, als Bildkomposition Bestand hätten. Es ist ernüchternd zu wissen, dass dem nicht so ist.
Diese Fotos sind Information, nicht mehr. Kalte, seelenlose, unkünstlerische Information, Bebilderung zu einer Mitteilung. Kontext allenfalls, vielleicht auch Erinnerungsstütze.
Von Motiv kann man nicht sprechen. Was ich da fotografiert habe, sollte Nutzen bringen, etwas zeigen, anstatt etwas darzustellen. Sie hatten und haben selbst keine Aussage. Sie sind reine Anhänge. Rein künstlerisch gesprochen wertloser Informationsmüll. Sie sind da, um einmal gesehen und danach vergessen zu werden.
Ist es das, wofür wir hauptsächlich Fotos machen? Um ein „Guck mal” in die Welt zu schreien in der Hoffnung, jemand blickt darauf, liked es kurz und hebt damit kurzfristig unseren Hormonspiegel an, weil wir damit wissen, dass man uns bemerkt hat?
Warum habe ich sie überhaupt noch?
Ich schaue nun auf all die Fotos und frage mich: Warum habe ich sie überhaupt noch, wenn sie für sich selbst nichts darstellen? Selbst Fotos von Orten und Landschaften sind langweilig, schnell dahingeknipst, wofür? Damit ich sie mir später einmal ansehe? Sie sind langweilig. Sie sind unausgegoren. Sie stellen überhaupt nichts dar, sind reine Funktion: Mich zu erinnern nämlich. Sobald ich auf diese festgehaltene Langeweile, dieses geknipste Unvermögen schaue, muss meine Erinnerung an den Tag, den Moment womöglich, den Rest übernehmen und die Langweiligkeit dieser Fotos ausgleichen. Was ich mir nicht ausdrucken würde, weil es einfach so schlecht ist, schaue ich mir doch auch auf Smartphone oder Tablet nicht mehr an. Oder ist der Anspruch bei digitalen Fotos so dermaßen gesunken?
Eigentlich könnte ich nun auf einen Schlag mehrere hundert Fotos einfach löschen, sie haben ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Sie gaben einer Nachricht Futter, einem Post ein Bild, sie waren Information zu einem bestimmten Punkt, als ich sie machte, um sie mitzuteilen. Niemand wird sich an die Nachricht erinnern, ebensowenig an das Foto. Die Info ist gegeben worden, die Info ist angekommen, die Info ist vergessen worden, danke, nächste – wie das so ist mit Infos. Ihr Nachrichtenwert dauert sogar noch kürzer als die Zeit, in der sie entstehen. Ex und hopp.
Und nun?
Wer damit, und warum mache ich das alles?
Alles löschen, weil eh alles überflüssig ist? Ja, zumindest das Meiste davon. Künftig bessere Fotos machen? Nun, wozu? Wenn die meisten ohnehin nur entstehen, um einer Nachricht als Anhang oder Kontext hinterhergeschludert zu werden, muss man sich nicht abmühen, Wertvolles zu machen – es wird auch gar nicht gelingen. Denn die Anlässe für derlei Fotos sind überhaupt nicht wichtig genug, um sich Mühe zu geben. Man wirft eine Information als Nachricht in den endlosen Strom anderer Informationen als Nachricht. Niemand würde die Mühe zu schätzen wissen, und sind wir ehrlich: Die Nachrichten selbst sind die Mühe nicht wert, weil sie nämlich keinen anderen Sinn haben, als das schon erwähnte „Schau mal“ zu bebildern. Es sind Nachrichten geringer Güte, die nur zeigen, schaut mal, wo ich bin, was ich habe, worüber ich mich freue. Sie sind Information zur Kommunikation, mehr nicht. Fotos sind sie vielleicht technisch, aber inhaltlich nicht. Sie sind die schlechte Serie ohne Sinn und Verstand, die technisch eine Serie ist, aber erzählerisch keinen Pfifferling wert ist.
Womit ich mich nun frage: Warum mache ich das alles? Eigentlich kann ich mir das Meiste davon sparen. Frei nach Rilke: Ich muss mein Leben ändern.