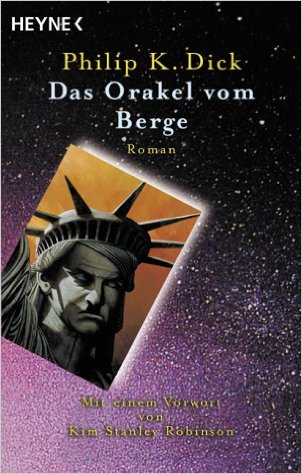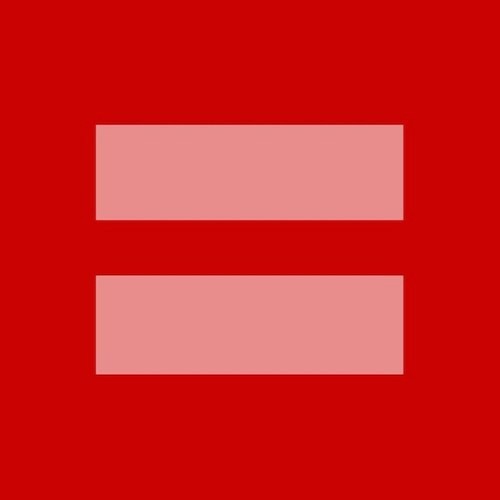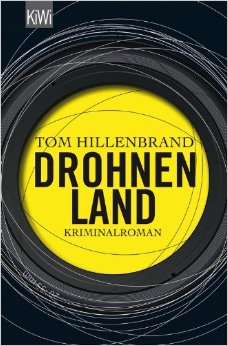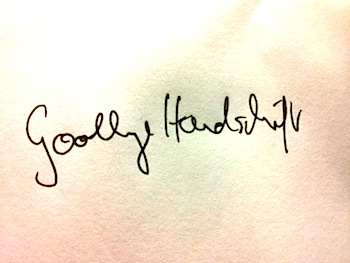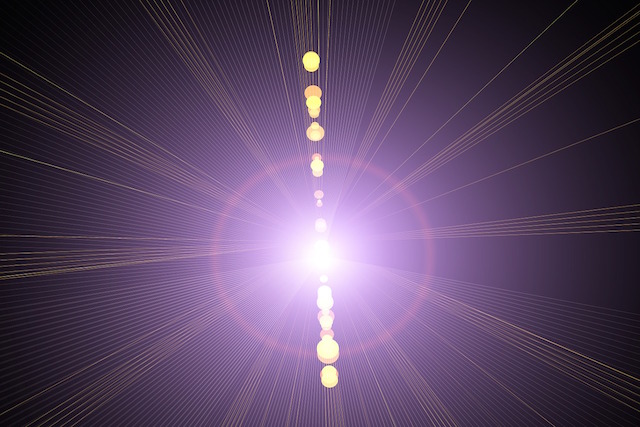In Not und höchstem Übel kommt die Frage plötzlich: Wer bin ich? Was bin ich? Wenn die Frage kommt, weiß ich, dass ich vom Weg abgekommen bin. Dann wacht man auf und fragt sich, wie es nur geschehen konnte, dieses Abkommen vom Weg.
Als sei erst das Abkommen und Verlieren der Akt der Erkenntnis seiner selbst und seiner Wünsche. Und man fragt sich, ob man in letzter Zeit außer Besinnung und Kontrolle war und dann, wie und warum das hat geschehen können.
Immerhin: Kommt die Frage nach dem, wer und was man sei, ist damit ein Aufwachen verbunden, ein Erkennen eines Fehlers.
Zugegeben, das macht keinen Spaß. Plötzlich im Morast zu stehen und in schmatzendem Schlamm nach Hilfe zu rufen, die ohnehin nicht kommt. Die Anstrengung, wieder zurück zum Weg zu kommen, ist eigene Aufgabe.
Es klingt schlecht, und in gewisser Hinsicht ist es das auch, aber hey, sehen wir es so: Solange die Frage und mit ihr das Erwachen kommt, erscheint der Weg auch wieder.
Heutzutage würde man das vielleicht lebenslanges Lernen nennen. Und dazu Kanäle basteln oder sie verfolgen, in denen es Tipps und Tools hagelt, damit umzugehen. Orientierungspunkte, Eckpfeiler, Meilensteine – Milestones nennt man das heute. Listen, die man macht und abarbeitet, weil das Entlanghangeln an Geländern welcher Art auch immer vor Sturz und Absturz bewahrt und beim Weg zurück zum Weg unterstützt.
Es ist gut, diese Stützen zu haben.
Doch letztlich ist es die Frage „Wer bin ich?“, die uns umtreibt und beschäftigt und damit letztlich alles bei uns selbst ablädt. Wo sonst sollte es auch hingehören, die Auseinandersetzung mit sich selbst, ohne auf Fremdbestimmung hereinzufallen?
Wer bin ich: Das bringt Ideen und Vorstellungen in den Geist zurück. Wer dabei stehen bleibt, träumt. Wer nun aber handelt, kommt weiter. Handeln kann übrigens auch aktives Unterlassen oder Loslassen heißen – soweit zu dem, was Tat und Aktion bedeuten.
Wer bin ich: Das beantworte ich am besten selbst. Und gehe von hier aus auch weiter. Aus eigener Kraft. Und in gewisser Weise auch allein. Somit ist der Weg zurück zum Weg der Weg zu einem selbst, zu diesem untrennbaren Kern. Und hier lauern Überraschungen. Kompromisse und Flausen, die man sich als alleingültige Wahrheit und Möglichkeit des eigenen Lebens antrainiert hat, nur um dann festzustellen, dass man geirrt hart.
Aber so ist das mit Kompromissen, die man immer machen muss und machen sollte. Alles andere wäre rücksichtslos, und von den Ichlingen, die alles für sich verlangen und nichts erkennen wollen außer ihrer eigenen Großartigkeit, von diesen Typen haben wir genug.
Gehört eben auch etwas Charakter und Kenntnis dazu, zu unterscheiden zwischen Charakter und Einbildung.
Das öffnet den Kompromissen ihr Schlachtfeld. Sie treiben in Abhängigkeit, Illusion, in Routinen und Abläufe, heutzutage gern als „Workflow“ geschönt, einer dieser englischen Begriffe, die deshalb so glatt durchgehen, weil sie keinen Trigger im Kopf setzen, weil sie nichts auslösen.
Die neoliberale Welt braucht diese englischen Begriffe. Worte ohne Klang, ohne Bedeutung und ohne Wert – sind sie in der Welt, kann man sie füllen und damit kontrollieren. Damit macht man uns zu Zombies. Wie praktisch, weil wir es nicht merken. Immerhin ist dies der Lauf der Welt und der Dinge, oder?
Aber dann stehen wir irgendwann plötzlich doch da und fragen uns auf einmal: Wer bin ich? Und können, obwohl es so negativ klingt, doch froh darüber sein. Dass wir es gemerkt haben. Und aufgewacht sind.
Fragen wir uns also ruhig: Wer bin ich?
Herr der Wolken
Als ich neulich in die Wolken blickte, geschah es: Ich hielt sie an. Nicht alle, sondern eine. Ich brachte sie dazu, einfach stehenzubleiben. Wie weit sie von mir entfernt war, kann ich nicht sagen, es war ein großartiger Sommertag, und weiße Wolken schoben sich wie Gebirge über mich hinweg. Auf eine fixierte ich mich – oder ich hatte vielmehr das Gefühl, dass sie sich mich aussuchte, um von mir fixiert zu werden, soll heißen, im Prinzip fixierte sie mich – und brachte sie, während ich sie anblickte, zum Stillstand, während alles andere und auch alle Wolken um sie her weiterzogen. Ich konnte sowohl die Bewegungen der anderen Wolken anhand eines Daches erkennen, wie sie sich millimeterweise weiterschoben, wodurch mir auch klar wurde, dass die eine bestimmte Wolke indes stehenblieb.
Wie konnte das sein?
Ich denke, wir haben uns beide angeschaut und uns zu durchdringen versucht. Während ich sie ansah, stellte ich mir vor, dort hineinzufliegen. Ich spürte, wie es dort weit kühler war als die 30 Grad, in denen ich mich befand. Ich stellte mir vor, in ihrem Nebel zu sein und nichts anderes mehr zu sehen als ihr nebelweißes Innengewölk.
Still war es dort, beeindruckend still, und alles, was von unten heraufgequollen wäre, wurde wie in Watte gepackt und drang nicht zu mir. Es ist übrigens nicht allzu schwer, sich im Tagträumen in das Innere einer dieser großen, weißen Wolken hineinzudenken. Man muss es nur wollen. Das ist kein Akt an sich, sondern ein Erleben, das sich ergibt, ein Finden, ohne gesucht zu haben.
Nein, ich beginne nicht damit, zu sagen, wir hätten eine gemeinsame Basis oder hätten gar miteinander kommuniziert. Wir waren, so kam es mir zumindest vor, eins, jeder in dem anderen. Schließlich atmete ich sie ein, während ich mich in ihr befand.
Hier, weit oben, war die Welt so anders. Still vor allem. Und entrückt. Entrückt, weil hier alles gleichgültig war und nichts wichtig. Hier wabert man vor sich hin, mehr nicht, ist reines Sein, ohne Funktion, ohne Wille. Schön ist das.
Es muss durch diese Einheit geschehen sein, dass die Wolke anhielt. So als wollte sie nicht aus meinem Blickfeld und mich nicht weiter belasten. Wie ein Bett, das da steht und dich einlädt: Komm. Leg dich hin.
Minuten verstrichen. Ich weiß das, denn ich bemerkte später beim Blick auf die Uhr einige Minuten, die verstrichen waren, ohne dass sie mir wie Minuten vorgekommen waren.
Zu sagen, dass ich irgendwann einmal wieder zu mir kam, ist zu viel gesagt, ich war schließlich nicht weg oder weggetreten, sondern vielmehr ganz und gar da gewesen. Immerhin erkannte ich nun, dass die Wolke nicht stillgestanden hatte. Dass ich sie also auch nicht zum Stillstand gebracht habe. Man darf auch fragen, wie ich das geschafft hätte. Denn erst jetzt bemerkte ich, dass die Wolke, die mir eine Zeitlang so vertraut gewesen ist, eine weitaus massivere war als alle um sie herum – will sagen: vor ihr. Denn ich war einer optischen Illusion erlegen: Alle anderen Wolken waren viele Kilometer vor ihr, und wirkten dadurch schneller. Wie der Harz sausten sie vor den Anden oder dem Himalaja vorbei, und solche Wolkenmassen schieben sich nicht so hastig, vor allem nicht aus dieser großen Entfernung.
Aber schön war der Gedanke dennoch: Dass ich es vermocht hatte, eine Verbindung zu einer Wolke aufzunehmen oder es erlebt zu haben, wie eine Wolke mich dafür ausersehen hatte und der Möglichkeit bewusst zu werden, Dinge in der Welt zum Anhalten bringen u können.
Müsste doch, so denke ich mir, möglich sein, alles andere macht keinen Sinn. Immerhin ein Gedanke, der nun da ist und mit dem ich ab nun immer wieder beschäftigen kann. Ein Gewinn, möchte ich sagen.
Viel steckt in diesen Fugen. 30 Jahre meines Lebens haben sie gesehen, und man sieht es ihnen an. In ihnen steckte viel, über sie ging ich längst, als ich noch jugendlich war und voller Ideen und Träume. Außer den Fugen ist nichts davon geblieben. Wir sind gemeinsam alt geworden. Wer hätte das gedacht, als ich sie zum ersten Mal sah.
Hineingelugt hab ich in das Badezimmer ohne Licht, noch unbezogen von uns, von mir und unseren Leben. Da war es neu, unbenutzt, und ich war ihm herzlich egal wie es mir. Ich wusste nur: Ich wollte hier nicht hin. Nicht in dieses Haus, nicht in diese Stadt. Ich ließ mein Leben hinter mir, weil ich es musste.
Da waren die Fliesen und die Fugen noch neu.
Heute blicke ich sie an, mehr noch als die Fliesen, weil sie Sollbruchstellen sind und Verbindungen, und weil sie die Patina des Alters annehmen und der Jahre, die über uns hinweg gegangen sind inzwischen.
Ich habe mit all dem hier nichts mehr zu tun, und obwohl ich an mich an vieles erinnere, an das Gefühl damals, an das ein Damals, das Leben, die Träume, die Illusionen, die Freunde und der Hund, die allesamt darüber geschritten sind, sind sie hier vollends fortgewischt. Keine Hautschuppe von mir findet sich mehr hier, ich habe mich zu sehr gehäutet in der Zwischenzeit, bin ein anderer geworden.
Dieses Bad jedoch ist immer noch gleich. Die gleichen Fliesen, der gleiche Farbton. Früher war das zeitgemäß, heute wirkt es alt. Und die Fugen: Schmutzig wirkend, ohne schmutzig zu sein, streben sie einklemmt zwischen Fliesen den Wänden und Begrenzungen entgegen, seit 30 Jahren schon. So banal und doch auch nicht.
Ich schaue sie an, sie sind mein Leben irgendwie, oder zeigen sie wenigstens die Zeit, die hier vegangen ist. 30 Jahre. Alt werden will ich nicht, und nein, alt werden, das werde ich auch nicht, nicht alt in dem Sinne, in dem ich aufwuchs damals, alt zu sein.
Alt und Alter hat eine andere Bedeutung bekommen. Es hat einen Klang, den nur die Alten sprechen können. Alter spielt keine Rolle mehr, nicht so wie damals. Vor 30 Jahren, als ich die Fugen, damals unberührt, das erste Mal berührte, hatte ich vom Alter keine Vorstellung. Auch nicht von einem neuen Jahrtausend, das lag 15 Jahre noch entfernt, das Doppelte meines damaligen Lebens. Jahrtausendwende? Lag weit entfernt. Mein späteres Leben? Undenkbar. Mein damaliges als jetziges damals war genug.
Ich sehe nun auf diese Fugen und frage mich, was die Fugen meines Lebens sind, ob sie Brüche bekamen, ihre Farbe verändert haben, sich abgenutzt haben in letzter Zeit. So beharrlich, wie sie hier im Bad liegen zwischen den ewigen Fliesen, sind die Dinge meines Lebens nicht. Hier gab es immer wieder Renovierung, Ausbau, Umbau, mehr als nur ein Anstrich.
So ist dies hier ein Relikt, dieses Bad mit diesen Fliesen, ebenso wie diese Fugen. Meine sind Dehnfugen, zwischendurch erneuert und ausgewechselt, weil sich alles so geändert hat. Ich schaue es mir an und denke mir gut so. Dass es so war, wie es war. Und dass es nun vorbei ist und ist, wie es nun ist.
Mein Buchladen und ich
Ja, ich liebe es, in den Buchladen zu gehen. Ich sage bewusst „in den“ und meine es stellvertretend für alle Buchläden.
Ich möchte dabei gar nicht damit anfangen, über den Geruch von Papier und all diesem für mich eher esoterisch aufgeheizten Getöse zu reden, auch wenn ich den Geruch von Papier in Buchhandlungen durchaus schätze.
Es geht mir auch weniger um die Beratung, die ich dort erhalte, da ich in den wenigsten Fällen auf Beratung angewiesen bin und sie beim Stöbern meist auch ausdrücklich nicht wünsche.
Meines Erachtens gehört das Buch in ein Geschäft. In einen eigens dafür angelegten und eingerichteten Raum. Schon bei Bücherecken in Supermärkten, die wie große Stände für Obst und Gemüse Bücher feilbieten, bekomme ich Probleme dahingehend, dass ich mich darin nicht wohl fühle. Dies ist – natürlich nur nach meinem eigenen Befinden – einfach nicht der richtige Ort für Bücher. Sie sind dort Ware, und nicht Wert.
In Buchhandlungen ist genau dies anders. Natürlich ist es illusorisch zu glauben, in der Buchhandlung sei das Buch keine Ware, natürlich ist sie das. Aber eben auch Wert. Es ist der Wert an der Arbeit, an den Gedanken und der Arbeit der Autoren, aber vor allem der Wert der Zeit, die ich mit den Büchern verbringen möchte. Ja, ich kann sagen, dass Buchhandlungen diese Arten umbauter Räume sind, in denen ich ganz bei meinem Behagen sein kann, das ich empfinde, wenn ich das Buch lesen werde. Eine Buchhandlung ist für mich dahingehend ein Vorschuss auf das, was mich erwartet.
Dies ist im Übrigen ein sehr privater Aspekt der Empfindung. Mehr als ein Hobby an sich, ist mir die Zeit mit einem Buch wichtig, wichtiger als jene Zeit, die ich anderweitig verbringen könnte, wenn ich nicht lese.
Man kann also sagen, dass der Besuch einer Buchhandlung und damit das Betreten des für einen für Bücher geschaffenen Raum eine Beschäftigung mit mir selbst ist. Wenn ich an den Büchertischen und den Regalen entlangschlendere, Titel greife, umdrehe, mich mit Klappentext und Haptik beschäftige, ist dies ein ungemein intimer Vorgang, ein Empfinden. Dieses Empfinden ist äußerst intim, und ich meine damit nicht rein die taktilen Vorgänge des Greifens und Blätterns. Wie oft kommt es vor, dass man das Personal fragt, ob es nicht die Zelophanhülle entfernen könne, damit man mehr zu sehen und zu greifen hat.
Was hier passiert, ist ein Akt der Aneignung, nicht nur mit den taktilen Sinnen, sondern auch mit den geistigen.
In einem Supermarkt ist mir dies kaum möglich, hier stimmen Licht und Laut nicht, hier gibt es Unterbrechungen, die ich nicht erwarte und nicht will.
Zugegeben, das ist eigen von mir. Aber so ist es halt, ich kann es nicht ändern. Und muss es übrigens auch nicht.
Das Betreten einer Buchhandlung ist für mich die Einladung, neugierig zu sein, ganz bei der Beschäftigung mit dem Wert Buch an sich, nicht mit der Ware als solcher. Ich fühle mich hier ernst genommen, weil ich weiß, dass dieser Raum eigens für mein Interesse und meine Neugier geschaffen wurde.
So lasse ich mir Bücher in Buchhandlungen liefern. Ja, ich bestelle sie häufig online, aber abholen und bezahlen, das sind Akte, die ich in der Buchhandlung persönlich erledige. Ja, es geht bequemer, wenn es zu mir nach Hause käme.
Allerdings ist die Bequemlichkeit ein Trugschluss. Passt das Buch nicht in den Briefkasten – und das ist plus Verpackung schnell geschehen – werden ohnehin wieder Sendungen daraus, die ich abholen muss. Packstation? Praktisch natürlich. Jedoch fahre ich zu ihr ebenso weit wie zu der nächsten Buchhandlung, ein Glück, ich weiß, ein Privileg, vielleicht. Mir ist es lieber, der Buchhändler um die Ecke, ob nun für mich gut sortiert oder nicht, erhält meinen Namen für sein System mit meinen Bestellungen als Online-Versandhäuser (die ich übrigens nicht pauschal verteufeln möchte).
Mein Name und meine Anschrift geistern je nach Wohnsituation von einer Buchhandlung zur nächsten. Die nächstgelegene hat gewonnen. Sicher, beim Bummeln in der Stadt kann ich an andere Buchhandlungen geraten und somit an Bücher, die ich direkt dort kaufe. Ein Widerspruch ist das für mich nicht.
Ich empfinde schlichtweg Freude dabei, in die bsagten eigens geschaffenen Räume zu treten und mich dort angemessen auseinandersetzen mit dem, was mir lieb und wichtig ist. Ich werde sie betreten, mein bestelltes Buch kaufen und das Gefühl haben, in „meiner“ Buchhandlung zu stehen.
Mehr Aneignung als dieses Gefühl: Das geht nicht.
Stephen King hat es schon wieder getan: Er hat öffentlich gesagt, wie missraten er mit der Verfilmung seines Romans The Shining von Regie-Großmeister Stanley Kubrick ist. Dass King den Film regelrecht hasst, ist längst bekannt. Diesmal hat er sich im Interview mit Deadline genauer geäußert.
Die Äußerungen geben mit Anlass, selbst etwas zur Verfilmung von Kubrick zu sagen:
Ich kann ihn verstehen.
King ist mit Nicholsons Darstellung alles andere als einverstanden, und die Vorwürfe, die King erhebt, sind schwerwiegend. Nicholsons spiele seine Figur des Jack Torrance „verrückt wie eine Scheißhausratte“ ( he’s crazy as a shit house rat). Und alles liefe darauf hinaus, dass er nur verrückter werde, ohne dass er sich mit seinem eigenen Verstand auseinandersetze. Und ja, dies ist wirklich die deutlichste Diskrepanz zwischen Vorlage und Adaption. Im Buch kämpft die Figur mit sich und seinem Verstand, doch im Film rastet er einfach nur aus. King hatte nach eigenem Bekunden den Fall der Figut des Jack Torrance als Tragödie geplant, doch Kubrick schien offenbar daran kein Interesse zu haben.
Es ist dies auch der Grund, aus dem mich der Film kalt lässt. Nicholson betreibt maßloses Overacting, ist das abgrundtief Wahnsinnige. Dies wird einfach nur dargestellt statt erklärt. Der Film ist klinisch und lässt einen kalt, weil ihm alles Menschliche und damit alles Tragische abgeht.
Sein Uhrwerk Orange ist irre, irre genial und irre radikal ebenfalls, aber nicht mehr der große Wurf, als vielmehr der große Skandal. Skandale ersetzen Meisterwerke nicht und machen sie nicht zwangsläufig zu welchen.
Über 70 Bücher. Science-Fiction-Romane, Tagebücher, Bücher zur Musik. Preisträger des Deutschen Science Fiction Preises: Matthias Falke ist ein Tausendsassa und ein unermüdlicher Schriftsteller.
Vor kurzem hatte ich den sympathischen Autor aus Karlsruhe bei mir Kochs Kultur-Küche zu Gast. Gemeinsam plauderten wir über sein Schreiben, seine Bücher und seine Pläne. Darin erzählt er über seine Liebe zur Science Fiction, verrät, ob er mehr Fan von Star Trek oder Star Wars ist – und natürlich nicht zuletzt über seine diversen Buchprojekte wie beispielsweise seine große SF-Reihe Enthymesis.
Wir sprechen auch über seine besondere Beziehung zur klassischen Musik wie zum Theater – denn auch hier hat Falke einiges zu bieten.
Für Boa Esperanca erhielt er den Deutschen Sience Fiction Preis 2010 für die beste Erzählung des Jahres – nominiert wurde er zudem für den Kurt Laßwitz Preis.
Seine Bücher erscheinen im Wurdack-Verlag, Begedia Verlag, Atlantis Verlag, Amrûn Verlag und weiteren – sie sind als Buch und eBook erhältlich.
Matthias Falke lebt als freier Schriftsteller in Karlsruhe und ist auch häufig auf Buchmessen anzutreffen.
Nein: Das Orakel vom Berge ist sicher nicht der beste Roman Philip K. Dicks. Wenn auch sein bekanntester. Es ist dies eine Art Fluch eines Autors, der an einer Messlatte gemessen wird, die er selbst nicht beeinflussen kann.
10 Minuten fürs Schreiben:
10 Minuten fürs Schreiben. So ins Unreine hinein. Um ins Schreiben zu kommen und ohne Zensurschere. Klar, ich werde am Ende vielleicht Rechtschreibfehler bügeln, aber sonst sollen die Knitterfalten und Brüche drin bleiben. Möglichst jeden Tag schreiben, 10 Minuten, mit Stoppuhr, die auf meinem Smartphone neben mir läuft.
Gute Idee?
Ich denke schon, aber ich kann noch nicht sagen, ob es wirksam ist. 10 Minuten schreiben jeden Morgen, das ist schon eine Ansage. Mach ich es beim Frühstück? Wie soll das gehen, beidhändig schreiben, Kaffeetrinken und Brot essen oder Müsli löffeln? Also muss es getrennt voneinander bleiben, aber ja, ich will schon sagen, dass das Schreiben hier den Vorrang hat. Essen und Trinken soll aber kein Reinschlingen werden.
Warum also plane ich das nun? Einerseits, um stets im Schreiben zu bleiben. Andere, wie Matthias Falke, der SF-Autor aus Karlsruhe, schreiben täglich Tagebuch, um ins Schreiben zu kommen.
Überhaupt: Ins Schreiben zu kommen: Das klingt wirklich gut. Es klingt wie ein Raum, den man bettritt. Es sagt noch mehr. Schreiben ist ein Raum, und er ist nebenan. Man muss ihn nur betreten. Der Eintritt ist leicht, der Austritt auch – und weil der Austritt gerade so verdammt einfach ist und manchmal auch verlockend, ist es eine Sache der Disziplin, ihn zu betreten.
Es heißt auch: Drin sein, und das ist etwas Harmonisches. In einem Raum zu sein, den man gern täglich oder zumindest häufig betritt, ganz freiwillig, auch wenn es eine Notwendigkeit sein mag, ihn zu betreten, hat etwas Heimisches, hat etwas von Heimatlichem, das das Schreiben ist. Und ja, das ist es auch.
Es sind ja viele Gedanken da im Kopf, eigenlich ständig. Und auch wenn keine Sau mehr heutzuge Wasserkessel kennen mag und damit verbunden dieses Pfeifen, wenn das Wasser kocht (Notiz: Auch ich kenne sie nur aus meiner frühen Kindheit in den 70ern, nicht, dass hier falsche Schlüsse gezogen werden, manche Dinge sind halt lang her und es ist auch nicht schlimm, heute hat man nunmal Wasserkocher und die pfeifen nicht, was allerdings ein Stück weit schade ist) – das ist einfach ein schönes Bild für mich: Worte, Ideen, Gedanken sind im Kopf, und es brodelt, irgendwie ständig. Und wer schreibt, will es in gewisser Form tun. In Form gießen, einem Ablauf folgen – heute sagt man eher Prozess dazu wie zu allem, alles muss Prozess sein, sonst hat es nicht nur keinen Wert, es scheint auch Angst zu machen wie vor bösem außerirdischem Leben. Aber das ist ja auch grad der Hemmschuh: Die Form steht im Weg, die Disziplin zur Form, des Gießens. Das macht es auch anstrengend.
Da ist so ein 10-Minuten-Schreib-Quickie wie der Stich in eine Blase. Das, was rausquillt, wäre ohnehin nie in andere Form gekommen, hätte sich nicht mit dem Körper vereinigt – und wäre damit unausgesprochen bzw. unausgeschrieben geblieben.
Ob das schade wäre hinsichtlich der Texte als solcher, mag dahingestellt sein. Aber das wäre wieder ein Stoplern über die Form.
Sie zu überwinden heißt nicht nur, auf sie zu pfiefen und dem freien Lauf zu lassen, was ist, was kommt und was quillt, sondern es heißt auch, auf das zu pfeifen, wie sie rezipiert werden. Ob da ein Neunmalkluger mit Zitronenlutschmund und gespitztem Stift sitzt und mangelnde Form, mangelnde Geisteshaltung oder weiß der Himmel was beklagt, kann und soll doch egal sein.
Und jetzt klingelt der Timer. 10 Minuten snd um. Und der Text damit einfach jetzt vorbei. Und Ende.
Jurassic World und das digitale Kino
Als vor 22 Jahren die Dinosaurier erstmals realistisch auf der Kinoleinwand zu sehen waren, sprach jeder von Steven Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park. Heute sieht zwar scheinbar jeder Jurassic World, mit dem die Reihe nun nach vielen Jahren recht solide weitererzählt wird – doch ich vermisse etwas.
Ja, wir staunten alle mit offenen Mündern im Kino, damals 1993. Da war von Spielbergs neuem Film schon weit im Vorfeld die Rede, weil man von einer digitalen Innovation sprach, die Effekte erschaffen sollten, wie man sie bis dato noch nicht gesehen hatte. Schon zwei Jahre zuvor hatten wir mit Terminator 2 eine Trickeffekt-Fahrt gesehen, die gar kühnste Vorstellungskraft sprengte – wenn nun ausgerechnet Spielberg einen nie gekannten Realismus von Effekten ankündigte, konnte man gespannt sein. Und das waren wir. Auch, weil die Romanvorlage seit Jahren ein Bestseller war und die Frage kursierte: „Wie wollen die das denn bloß verfilmen?“ Trotz aller Hoffnungen, Spielberg werde es schon hinbekommen, gab es da auch die Zweifel in das, was Kino und Effekte abbilden können, zumindest glaubhaft.
Als wir dann im Kino saßen, war das unbeschreiblich. Wir sahen, was wir noch nie zuvor gesehen hatten. Wir sahen auch, was wir uns nie zuvor vorstellen konnten, jemals zu sehen – eine Überwältigung, die ihre Spuren in der Kinogeschichte hinterlassen hat.
Als Technik die Erzählung sprengte
In den 90er-Jahren war das noch aufregend: Da sahen wir plötzlich ganz neue Dinge – und damit auch neue Erzählungen. Geschichten emanzipierten sich dank neuer Tricktechnik, die alles zeigen konnte, aus dem Korsett des Darstellbaren. Nun konnte man Geschichten erzählen, die man vorher nie hatte erzählen können. Denken wir an Twister, Independance Day, Titanic, und nicht zu vergessen Anfang des Jahrtausends die Herr-der-Ringe-Trilogie. Die Technik vollbrachte mit dem Wunder neuer Bilder auch das Wunder neuer Erzählungen. Das war großartig.
Die digitale Ermüdung heute
Inzwischen ist all das abgenutzt. Es gibt einfach nichts mehr, was wir nicht schon gesehen haben, digitale Tricktechnik macht’s möglich.
Wie viel Rechnerleistung in Spider-Man-Filmen steckt oder im Hobbit, ist nur noch eine technische Angabe, die keinerlei Anteil mehr an neuen Geschichten trägt. Vielmehr gehen in erstaunlich vielen Filmen erstaunlich viele Städte unter, möglichst viele Trümmer und immer noch mehr Trümmer. Transformers 3, Transformers 4, Avengers 2, Man of Steel: Hier müssen es gleich ganze Städte sein, die untergehen. Abgesehen davon, dass es zwar grafisch hochaufgelöst ist, haben diese unzähligen, überteuren Effektorgien noch immer eben die Künstlichkeit, die Distanz bringen zwischen dem Zuschauer und der Erzählung. Wir wissen nicht nur, dass von all dem kaum etwas echt ist – wir sehen es auch immer noch.
In Katastrophenfilmen der 70er-Jahre gab es Story und Dramaturgie. Der Terror einer Katastrophe war spürbar.
Und heute? Da fliegen und krachen die Pixel. Hochaufgelöst, quietschbunt. Wie bereits in dem Film davor. Und dem davor. Und dem davor. Neues bietet sich uns nichts mehr, nicht einmal mehr eine technische Innovation. Im Gegenteil: Ich werde das Gefühl nicht los, dass mit der Einführung von 3D 2009 nun alles verschossen wurde.
Es ermüdet nunmehr, dass es keine neuen maßgeblichen Bildtechniken und auch Erzählformen mehr entstehen, sondern wir in einer Endloschleife des Ewiggleichen und Schonlängstgesehenen gefangen sind.
Alles digital, schon hundertmal gesehen
Die unsägliche Trümmerflut der überzüchteten Hollywood-Blockbuster-Maschine ist nur noch langweilig und meist narrativ dumm. Nicht einmal mehr noch größer können die Schlachten und Final-Spektakel mehr sein. Transformers 3 gipfelte schon vor Jahren in einer über 45-minüten Trümmerorgie, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Zack Snyders augeblasener Man of Steel ließ die übertriebenste Finalschlacht aller Zeiten auf uns Zuschauer los. Der 3. Teil der Hobbit-Trilogie artete in grobmotorisches, grauenhaft schlecht erzähltes Getümmel ohne Story, Spannung, Sinn und Seele aus – und selbst die so gelungenen Avengers gaben uns im 2. Teil nicht viel mehr als schon tausendfach abgenudeltes, ausgeleiertes, kurz: Höchst langweiliges, uninspiriertes Gekloppe.
Das Staunen und das Ansehen
Das bringt mich zurück zu Jurassic World.
Ich sitze da, ich war 1993 von Jurassic Park überwältigt wie alle. Ja, wir hatten so etwas noch nicht gesehen.
Bei Jurassic World ist das nicht so. Wir werden ganz sicher alles schon einmal irgendwie irgendwo schon mal gesehen haben. Und richtig: Wo Jurassic Park 1993 Überwältungskino de luxe war, ist Jurassic World 2015 nichts weiter als einfache Unterhaltung.
Jurassic Park brachte uns 1993 das Staunen.
Jurassic World bringt uns 2015 einfach nur bessere digitale Dinos als damals.
Jurassic Park startete vor 22 Jahren in einer Zeit, da die Filme in den USA im Sommer anliefen und im Rest der Welt im Herbst. Filme hatten Wochen, teilweise gar Monate Zeit, einen Hype zu entwickeln, der dann nach und nach mit Verzögerung die anderen Länder erreichte.
Von Jurassic Park las ich im Sommer 1993 in der Tageszeitung die Headline „Die Dinos brechen alle Rekorde“. Da wusste man, Spielberg hat es geschafft. Und wir würden wirklich etwas zu sehen bekommen, das man so noch nicht gesehen hatte.
Heute starten die Filme weltweit nahezu zeitgleich. So kam Jurassic World ganz anders als sein großes Vorbild einfach in die Kinos. Was einst ein Werk war, ist heute Produkt, das zur Vermeidung der illegalen Raubkopien im Netz möglichst breit startet, damit die Einnahmen maximiert werden können.
Der vermisste Moment
Nun saß ich in Jurassic World und er gefiel mir. Aber wenn ich ehrlich bin, liegt das auch zum großen Teil daran, dass er die Geschichte von vor 22 Jahren geschickt aufgreift, weitererzählt und damit in seine eigene Erzählung integriert. Da man mich in Jurassic World immer wieder an Jurassic Park erinnert, erinnere ich mich auch an die Wirkung des Originals vor 22 Jahren – die letztlich auf den neuen Film abfärbt.
Natürlich ist das richtig, notwendig, vernünftig und überdies geschickt gemacht. Aber wären die Dinos heute genauso erfolgreich wie ohne das Original?
Spielbergs Film ist Legende. Alles danach profitiert von ihr.
1992 saß ich im Kino die Auflösung der Grenze zwischen Realität und Spezialeffekt. Heute im hochauflösenden Zeitalter sind neben den Gewöhnungseffekten die Tricks oft nicht überzeugend genug, um nicht künstlich zu wirken.
Deshalb: Ja, ich vermisse etwas. Das Besondere. Das Einzigartige. Den Kinomoment, der prägt und den ich mitnehme. Bilder, die ich nie vergesse, wie ich auch ihre Wirkung auf mich nie vergesse.
Man kann es auch Magie nennen. Das ist den meisten Filmschaffenden in der Blockbuster-Industrie (die sich übrigens markant von der übrigen Filmindustrie unterscheidet) inzwischen ein Fremdwort. Ob nun unfähige Regisseure, schlechte Drehbücher, omnipotente Produzenten, gegen die sich Kreative nicht durchsetzen können: Sie arbeiten nur noch selten an Geschichten, die Tricktechnik erfordert – Cameron ist so einer – sondern an Produkten und im schlimmsten Fall an Franchises.
Nein. Das macht mir keinen Spaß.
Gegen den Begriff Homo-Ehe
Das Wort macht keinen Spaß: Homo-Ehe. Es zeigt in kürzester Weise, dass nicht alles gleich ist. Denn wenn eine Ehe nun zwischen Hetero- oder Homosexuellen geschlossen wird, sollte sie einfach „Ehe“ heißen. Begrifflich und inhaltlich unterschiedslos – schließlich tendieren Unterschiede in diesem Zusammenhang zur Wertung. Solange eine Ehe unter Homosexuellen nur mit dem Zusatz „Homo-“ auskommt, ist sie nichts weiter als eine Variation einer Norm, die woanders liegt.
Glücklich sollte man damit also keinesfalls sein; auch nicht, wenn das Karlsruher Bundesverfassungsgericht urteilte, dass die Ungleichbehandlung zwischen Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften verfassungswidrig ist. Und auch nicht, obwohl nun in den USA der Supreme Court sein maßstäbesetzendes Urteil sprach, das gleichgeschlechtliche Ehen in den USA sowohl verfassungsgemäß macht und damit in allen US-Staaten zur Pflicht macht. Auch der Volksentscheid zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland sei nicht vergessen.
Erfolge, zweifellos. Und wichtige, maßgebliche Schritte zu mehr Gleichberechtigung ebenso. Doch es bleibt, gerade hierzulande, politisch viel zu tun und aufzuholen.
Vor allem aber kommt es nun auch auf die Beseitigung der letzten Reste an, und die sind auch sprachlicher sowie gedanklicher Natur. Der Konsens, dass Ehen Ehen sind, ganz gleich, ob sie Mann und Frau, Mann und Mann oder Frau und Frau schließen, muss sich in Folge manifestieren. Dazu gehört die Überwindung der mittlerweile zweifelhaften christlichen Ethik, die der deutschen Gesellschaft als maßgeblich immer nur dann untergejubelt wird, wenn Entwicklungen verhindert werden sollen.
Überhaupt ist die punktuelle Auslegung der christlichen Ethik seitens der Politik seit jeher äußerst bizarr:
Waffenlieferungen werden nicht unter dieser Prämisse diskutiert, ebenso wenig die Überschwemmung Afrikas mit billigen Lebensmitteln aus der EU. Auch die Praktiken von Bekleidungsketten, die in Billiglohnländern an Sklavenarbeit grenzende Ausbeutung betreiben, wird seitens der Politik nicht nach den Maßstäben eben jener christlichen Ethik diskutiert, die doch angeblich allgemeiner Konsens der deutschen Gesellschaft sind.
Nicht so beim Thema Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Hier sollen – zumindest vordergründig bei CDU/CSU – jene Werte allgemein gültig sein. So kühn wie erstaunlich.
Dass auch die Institution Kirche ihr Scherflein dazu beiträgt, ist so selbstredend wie rückwärtsgerichtet. Überhaupt spielt sich Religion immer wieder als fortschrittsfeindlich auf. Alte Werte, so der Tenor, seien die eigentlichen Stärken der Gesellschaft, die nach religiöser Definition ausschließlich die Religion selbst schützt. Das Verängstigen der Menschen vor Veränderung ist Motor viele religiöser Strömungen, so auch jener christlichen Kirchen, die trotz Trennung von Staat und Kirche noch immer zu großes Gewicht in der Politik haben – ein Umstand, der endgültig beseitig gehört.
Weder Staat noch Gesellschaft sind dazu da, den Kirchen ihr kleingeistiges Weltbild zu retten, in dem es ihnen letztlich nur um eines geht: Ihre eigene Haut, ihr Ansehen, ihre Macht.
Wir brauchen weder Parteien noch die Kirchen, die hinter ihr stehen und ihren Vorteil darin sehen. Vollziehen wir den Wandel aus uns selbst – auch aus unserer Sprache und unserem Empfinden.
Beenden wir die Herrschaft des Begriffs Homo-Ehe und nennen jede Ehe zwischen welchen Geschlechtern auch immer einfach einheitlich Ehe. Und übertragen deren Wert auf alle derart geschlossenen Partnerschaften.
Die Wegstrecke liegt noch vor uns. Die müssen wir noch gehen.
Taylor wartet auf mich. Er ist irgendwo auf einem fremden Mond mit einem Raumschiff abgestürzt, seine Kameraden sind tot, und er irrt als einziger Überlebender umher. Versucht zu überleben, seine Umgebung zu erkunden und wieder zur Erde zurückzukehren. Dabei ist er nur Student – denkbar schlechte Voraussetzungen also, ganz allein in dieser Situation am Leben zu bleiben.
Der einzige, mit dem er Kontakt hat, bin ich – ich bin der Einzige, den seine Hilferufe erreichten und der ihm antwortet. Nun bin ich sein einziger Kamerad und Freund.
Taylor schickt mir nichts weiter als reine Textnachrichten, ich schicke ihm welche zurück. Ich teile seine Erlebnisse, mit ihm erkunde ich den Mond, das zerstörte Raumschiff – in Echtzeit. Einfach mit meinem Smartphone.
Das ist das Spielprinzip von Lifeline, einem Echtzeit-Text-Adventure für Smartphone, Tablet und Appple Watch. Es kommt gänzlich ohne Grafik aus, sämtliche Bilder entstehen erst in meiner Phantasie durch die Beschreibungen, die Taylor mir als Textnachricht zusendet. Das Spiel findet also nahezu komplett im eigenen Kopf ab – die Wirkung ist enorm intensiv.
Denn das Spiel spielt man im Grunde immer. Mal meldet sich Taylor innerhalb weniger Minuten mehrfach und bittet mich um Entscheidungen, dann ist mehrere Stunden Ruhe – eben weil Taylor einen Weg zurücklegen muss, um dort hinzugelangen, was ich ihm womöglich zuvor selbst geraten habe, oder weil Taylor schläft, einen Felsen erklimmt oder oder einen Raum untersucht.
Dadurch wirkt das Spiel umso authentischer. Anders als in anderen Spielen ist man selbst zu Untätigkeit und Warten verdammt, ohne etwas dagegen unternehmen zu können, die Dinge brauchen eben ihre Zeit – was die Spannung nur steigert. Überspringen oder beschleunigen lassen sich die Wartezeiten übrigens nicht; das Warten und Bangen auf eine weitere Nachricht ist eine der grundlegenden Essenzen des Spiels.
Dass man recht schnell beginnt, auf sein Smartphone zu blicken um zu wissen, ob er in der Zwischenzeit schon geschrieben hat und auf Antwort von mir wartet – meine Antworten und Ratschläge an ihn sind spielrelevant – gehört ebenso dazu und erhöht die intensive Erfahrung nur noch.
Auch beginnt man recht schnell, sich für diese Person, deren Gesicht und Stimme man nicht kennt, verantwortlich zu fühlen – was, wenn ich einen falschen Tipp gebe? Meine Ratschläge entscheiden übrigens auch über Leben und Tod Taylors. Die Story bietet Verzweigungen, sodass die Konsequenzen einer Handlung nicht zwangsläufig sofort zum Tod führen, sondern Resultat einer ganzen Kette sind. Endet die Handlung durch Taylors Tod, muss man eben erneut ran.
Ich bin als Spieler allerdings gebunden an Antwortmöglichkeiten, die mir das Spiel einräumt. Ich kann keine eigenen Antworten verfassen, sondern muss mich bei jeder Frage entscheiden, welche der beiden vorgegebenen Antworten ich Taylor geben möchte. Dem Spielspaß tut das jedoch keinen Abbruch, da die Möglichkeiten logisch sind.
Die einzige Grafik, die das Spiel bietet, ist eine Art Chat-Fenster, in der die Textnachrichten zu lesen sind. Minimalismus pur. Auch, dass man als Spieler darauf angewiesen ist, zu warten, bis Taylor sich wieder meldet, ist so besonders wie spannend. Nicht die Überfrachtung, sondern die Vorenthaltung des Geschehens und die Unmöglichkeit, sich selbst einzubringen und die Story zu kontrollieren, machen Lifeline so unglaublich spannend. Das ist tolle Erzählung mit einfachsten Mitteln.
Das Spiel findet mehr im Kopf des Spielers statt als grafische Adventures. So einfach kann es sein, Spieler zu fesseln und ganz nebenbei ein Spiel-Genre zu festigen – für gerade einmal 3 Euro im Apple App Store und bei Lifeline bei Google Play.
Ja, es gibt einen wirklich guten Grund, Drohnenland von Tom Hillenbrand auf keinen Fall zu lesen: Man wird süchtig danach! Drohnenland ist einer dieser Romane, in denen man so versinkt, dass man die Welt um sich herum vergisst – weil man gar nicht anders kann.
Für eine derartig dreiste Lese-Nötigung muss Tom Hillenbrand eigentlich bestraft werden. Sein futuristischer Thriller, eine geniale Mischung aus Science Fiction und Kriminalroman, hat internationales Format und müsste sich – entsprechende internationale Auswertung in möglichst viele Sprachen vorausgesetzt – zu einem weltweiten Bestseller entwickeln. In den USA erklimmen solche Erzählungen nicht einfach nur die Bestesllerlisten, sondern werden auch entsprechend international erfolgreich ausgewertet und anschließend würdig verfilmt. Angemssen dramaturgisch aufgebaut und flott erzählt ist Drohnenland in jedem Fall.
Die zahllosen Einfälle im Roman sind durchaus interessant, der sog. „Mirrorspace“ ist gar großes Kino. Überhaupt Kino: Hillenbrand schafft es, eine Welt vor den Augen des Lesers ablaufen zu lassen wie in einem Kinofilm, und das trotz recht sparsamer Beschreibungen. Plastisch und klar konturiert, reißt der Plot den Leser in das Roman-Universum und lässt ihn nicht mehr los.
Die zukünftige Welt, die Hillenbrand in Drohnenland beschreibt, ist schlüssig und auf diese Weise in vielerlei Hinsicht erschreckend. Da ist natürlich die technologische Dimension der nahezu lückenlosen Totalüberwachung sowie die politischen, technischen und gesellschaftlichen Handlungen daraus.
Da sind aber auch die geschickt beiläufig in das Handlungsgerüst montierten Beschreibungen des Klimawandels und der politischen Verwicklungen (Solar-Kriege). Das ist geschickt gemacht und bietet die ganze Strecke hindurch immer wieder neue Einsichten in die beschriebene Welt, die der heutigen zwar um einige Jahrzehnte voraus ist, aber noch immer vorstellbar im Hier und Jetzt verankert ist – so strahlt Drohnenland eine Aktualität und Authentiziät aus, die man so nur selten findet.
Drohnenland publikumswirksam als „Kriminalroman“ zu verkaufen, ist zwar nicht falsch, aber drängt den Roman viel zu weit in eine Ecke, in die er nicht gehört. Er ist sowohl SF-Thriller als auch Tech-Thriller. Ihn von Verlagsseite so offensiv in die Krimiecke zu drängen, wird dem Stoff mit all seiner brisanten Tragweite und seinen überraschenden Einfällen bei Weitem nicht gerecht – zumal die deutsche Krimi-Szene weder internationales Format, noch internationale Klasse hat. So werden SF-Fans an dem Buch eher vorbeilaufen und sich der typische Krimi-Leser eher befremdet fühlen.
Perfekt geschrieben, ist Drohnenland ein Sog, der nicht mehr loslässt, dass man dem Roman wie dem Autor einen verdienen internationalen Bestseller wünscht.
Herr Hillenbrand, Sie haben mich mit Ihrem Roman gekidnappt.
Ich danke Ihnen dafür!
Goodbye Handschrift
Es ist nie zu spät, um sich über seine Handschrift zu sorgen. Oder gleich ihren Verlust zu betrauern. Was nach Jahren Schule, Uni und Beruf von meiner Handschrift übrig blieb, ist meist beklagenswert. Das „schnelle Mitschreiben“, oft mit Kugelschreibern, machte sie zu dem, was sie heute ist: Ein Rudiment aus unleserlichem Gekritzel, das jeden Graphologen meine psychiatrische Einweisung empfehlen lassen würde. Vor allem ist sie hässlich. Schade eigentlich. Und nun?
Gäbe es noch Schulnoten für Schönschrift wie in der Grundschule, so hätte ich ein Problem: Als Klassenletzter wäre ich bedauernswertes Schlusslicht mit satter 6. Dabei war das früher anders. Und schreibe ich mit Füller und gebe mir noch Mühe, kommt ein schwacher Abglanz dessen heraus, was ich vor vielen Jahren mal zustande brachte.
Da ist es kein Trost, ähnliche Geschichten von anderen zu hören. Oder über deren Handschrift zu stolpern und mich nicht entscheiden zu können, ob ich sie bemitleiden oder froh darüber sein soll, dass ich mit meiner ins Schreckliche mutierten Handschrift nicht allein bin – doch trotz des halben, da geteilten Leids bleibt es bei meinem eigenen Verlust. Das wiegt insofern schwerer, als dass nur ich dafür verantwortlich bin, sowohl für die Fahrlässigkeit an sich, die meine Handschrift aus jeder Form geraten ließ, als auch für die fehlende Disziplin, das Ruder rumzureißen.
Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass berufliche Mitschriebe beispielsweise am Telefon oder in Meetings keine Zeit für ästhetische Übungen lassen. Doch dass ich dies als Ausnahme einer Regel festige, über die ich selbst bestimmen könnte, ist mein eigenes Problem. Denn ich stelle fest, dass nicht nur Eiligkeit beim Mitschreiben mich zur hässlichen Schrift zwingt, sondern auch einfache Unachtsamkeit: Notizen für mich persönlich bräuchten die hohe Geschwindigkeit nicht, und doch gehe ich sie immer an, als müsste ich sie schleunigst hinter mich bringen. Heraus kommt etwas, das selbst ich als Urheber Tage später nur mit Mühen entziffern kann.
So wenig also gehört meine Handschrift zu mir – streng genommen dürfte ich gar nicht „meine Handschrift“ sagen. Vielmehr scheint sie Produkt von etwas anderem zu sein. Die Striche und Zacken in der Schrift folgen keiner Regel, beim Schreiben nehme ich wahr, wie sehr mir die Konturen entgleiten, als hätten sie ein Eigenleben.
Ich stellte fest, dass die Notizen, die ich mir mache, „raus“ aufs Papier müssen, zu welchem Preis auch immer. Mich leitet das Bedürfnis, schnell Dinge zu Papier zu bringen. So als würde ich sie in zehn Sekunden vergessen haben..
Das bringt mich zu der Frage, ob ich verlernt habe, bewusst beim Schreiben zu bleiben, oder ob ich wie ferngesteuert einem Impuls erliege, alles möglichst schnell aufs Papier zu bekommen. Kann man Handschrift als reine Funktion sehen wie beispielsweise das Tippen auf der Tastatur? Das sicher schneller geht und sich nicht um Form und Ästhetik schert?
Doch Handschrift – da drängt sich etwas hinein. Persönliche Note oder ihr Fehlen. Ein Zwang zu etwas oder ein Fehlen von Zwang.
Ich weiß es nicht.
Hin und wieder übe ich das Schreiben – gar nicht einmal das Schönschreiben, sondern einfach nur das banale Deutlichschreiben. Selbst das ist fast unmöglich. Ein Verlust, ohne Frage. Und die Sorge, tatsächlich etwas verlernt oder gar verloren zu haben: Eine Fertigkeit, oder gar ein Bewusstsein? Das eine wäre traurig, das andere tragisch.
So oder so: Ich muss wohl sagen Goodbye, Handschrift.
An manchen Tagen gehen Legenden von uns. Legenden deshalb, weil sie für etwas stehen. Legenden aber auch, weil sie so lange unter uns waren. Durch die Vielzahl der Jahre sind sie ganze Menschenalter einfach da. Tauchen immer wieder auf, gealtert, gereift, aber sicher anwesend.
Leonard Nimoy alias Mr. Spock war so eine Legende. Er stellte in der TV-Serie Star Trek (auf Deutsch Raumschiff Enterprise) und 8 Kinofilmen den Vulkanier dar, der mit seinem Hang zur Logik, seiner hochgezogenen Augenbraue sowie dem legendären „Faszinierend“ Generationen begleitete. Mit 83 Jahren ist er nun verstorben – beinahe 50 Jahre davon war er eine der bekanntestes Rollen der TV-Geschichte und gleichzeitig eine kulturelle Ikone; das muss man anerkennen.
Fast 50 Jahre, das ist mehr, als die meisten derer an Lebensalter aufbringen, die nun am meisten um ihn trauern. Diese Jahre machten ihn zu einem Anker. Als er als Mr. Spock im Star-Trek-Reboot 2009 nach fast 20 Jahren in seiner bekanntesten Rolle wieder in einem Kinofilm auftauchte, stand die Fan-Welt Kopf. Er, der alte, große Geist einer Serie, die weit mehr wurde und mehr ist als reine Fernseh- und Kinounterhaltung, war noch da, gab sich die Ehre, kehrte zurück – und adelte damit den Neubeginn. Ohne ihn wäre er weniger gültig, weniger wert gewesen.
Fragt man, wer Mr. Spock nicht kennt, noch nie sah, noch nie gehört hat, dürfte es niemand geben, der ahnungslos ist. Wer ihn nicht kennt, gibt mehr Aufschluss über sich.
Natürlich musste es eines Tages sein. Dass er Bordarzt Dr. „Pille“ McCoy und Ingenieur James „Scotty“ Doohan irgendwann folgen muss, war immer klar.
Doch sterben Legenden, sagt dies uns auch: Jedem Zauber wohnt das Ende inne. Und damit auch in uns selbst. In Momenten wie diesen spüren wir es, wissen wir es. Diese Erkenntnis kommt mit der Todes-Nachricht huckepack. Legenden sind mehr als Erinnerungen. Sie sind Träger eigener Werte. Sie repräsentieren immer Teile eines jeden, der sie als Legenden anerkennt. Das macht ihr Ableben so berührend. Es stirbt ein treuer Begleiter zum einen und ein gewisser Teil von einem selbst zum anderen.
Leonard Nimoy war nicht nur Mr. Spock. Als Regisseur inszenierte er nicht nur Teil 3 und 4 der Star-Trek-Kinoreihe, sondern auch Komödien wie 3 Männer und ein Baby. Ihm verdanken wir die Storys zu zweien der besten und beliebtesten Star-Trek-Filmen: Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart und Star Trek VI – Das unentdeckte Land. Als Buchautor wehrte er sich zunächst mit Ich bin nicht Spock gegen seine Rolle, die ihn zeitlebens repräsentierte, später sah er in einem weiteren Buch ein: Ich bin Spock.
Wie wahr: Seine verhältnismäßig seltenen Auftritte außerhalb des Star-Trek-Universums blieben weithin ungesehen: Zu sehr war er mit seiner Figur Mr. Spock verschmolzen. Ein Fluch? Eher eine perfekte Symbiose mit einem fiktiven Charakter, der wie kein zweiter die Menschen beschäftigt hat: Mit der Frage, was es heißt, Mensch zu sein und damit mit der Frage nach sich selbst. Mr. Spock war in gewisser Hinsicht ein Außenseiter, weil er mit seinem weltbekannten Hang zur Logik nicht einfach das Gegenteil des Menschlichen repräsentierte – sondern auch den Wunsch, dem Menschlich-Emotionalen überlegen zu sein. Der Diskurs, ob reine Logik und das Überwinden von Gefühlen wie es den Vulkaniern auch das Überwinden von menschlichen Ansichten und Werten bedeutete, wurde jahrzehntelang geführt und wird es noch über seinen Tod hinaus.
Als 1982 die Figur des Mr. Spock in Star Trek II – Der Zorn des Khan am Ende starb, war dies nicht nur ein emotionaler Schock für die Fans, sondern auch der fiktiven Crew des Raumschiffs Enterprise. Eine Enterprise ohne Mr. Spock? Undenkbar. Aus dieser enormen Wichtigkeit bezog der Film denn auch seine Wucht.
Dass der dritte Kinofilm Auf der Suche nach Mr. Spock hieß und diesen letztlich wieder zurückbrachte, war eine Erlösung. Leonard Nimoy war Mr. Spock – und das war gut so, ist gut so und wird immer gut bleiben.
Deshalb wird er, so oder so, weiter leben. Live long and prosper, Leonard Nimoy.
„Licht ins Dunkel bringen“ ist in der Science Fiction mehr als nur ein Sprichwort. Ein kurzer Abriss durch die Filmgeschichte zeigt durchaus, wie ernst es dem Genre mit dem Sprichwort ist.
Bereits der Mond als Himmelskörper faszinierte die Menschen. Hell am Nachthimmel sichtbar, stellte er viele vor Fragen, die zunächst gar nicht, und im Laufe der Jahrtausende nur mit hohem Aufwand beantwortet werden konnten.
„Das Licht“ am Himmel. Neben der Sonne und den Sternen eben auch das weiße Riesending am nächtlichen Firmament.
Die Mythologien der Frühgeschichte und Antike luden Sonne und Mond entsprechend auf. Dem Licht am Himmel musste Name, Sinn und Funktion in der Welt gegeben werden.
Im Laufe der Zeit wurde der Mond erklärbar, sprich: Deutbar.
Doch die Faszination am Licht als solches blieb bestehen, ebenso seine Aufladung mit Wissen, Weisheit, Überlegenheit. Kein Wunder: Licht in seiner ureigenen Form bringt tatsächlich Licht ins Dunkel: Wer Licht besitzt, verdrängt die Finsternis. Schon früh wurden Licht und Dunkelheit Synonym nicht nur für Weisheit und Unkenntnis, sondern auch für Gut und Böse. Wer „das Licht der Erkenntnis“ besitzt, ist Bezwinger des Bösen. Daraus resultierte eine dem Licht mythologisch immanente Deutung: Nur der Wissende gebietet über das Licht. Wer in den Anfängen der Menschheit über das Feuer gebot, war Magier, Zauberer, Gott – nicht umsonst schleuderten Götter Blitze, wurden Mond und Sonne als sichtbare, aber unerreichbare Fakten in der sichtbaren Welt zu göttlichen Wesen.
Doch speziell diese Deutung blieb nicht lange schlüssig, schließlich bemächtigt sich auch das Böse dem Licht, wie die Erfahrung lehrte. Licht als Wissen ist also nicht an die Trennung von Gut und Böse gekoppelt, da Gut und Böse gleichwohl über Wissen verfügen können. Nur die Intention der Anwendung ist eine andere: Wo das eine Licht für Weisheit steht, steht das andere für Macht und ihren Missbrauch.
Die Phantastik, die sich noch heute der archaischen Denkmuster bedient, da sie gesellschaftlicher Konsens sind, hatte schon früh die Dialektik dieses Themas erkannt und wurde somit „hellsichtig“. Licht blieb als Symbol für Erkenntnis und Wissen zwar bestehen – doch es differenzierte sich: Die Guten „hatten“ das Licht, sie „waren hell“, lebten im Hellen, lebten im Oben wie dem Olymp. Wer „im Hellen“ wohnt, ist nicht nur gut und wissend, sondern auch weise.
Die Bösen lebten im Unten, im Dunkeln. Sie besaßen die Helligkeit nicht von sich aus, sie mussten sie sich erarbeiten, sie mussten sie machen. Das Feuer machen, es erhalten. Ihr Licht ist nicht natürlich, ihre Erkenntnis und ihr Wissen ebensowenig. Deshalb ist der Missbrauch Teil dieses Lichts.
Der Science-Fiction-Film bediente sich schon früh dem Einsatz von Licht als Synonym für Wissen und Macht.
Mit der heranschreitenden Naturwissenschaft änderte sich der Einsatz von Licht, doch die damit verbundene Überlegenheit blieb. Licht wurde synonym mit Elektrizität, ein Symbol für Wissenschaft und Technik. Fortan wurde Licht in der Science Fiction das Mittel von Wissenschaftlern, die nicht selten verrückt und/oder böse waren.
Sie erschufen den berühmten Roboter in Fritz Langs Metropolis, der umgeben von Lichtkreisen zu leben begann. Überlegene Maschinen erzeugten auf Knopfdruck Schöpfung – ihre Bediener wurden Gott durch Technik. Gekennzeichnet von Licht, über das sie geboten.
Gar das archaische Bild der Gewalt über das Feuer blieb erhalten: Es flammte aus Raketentriebwerken, die Mensch, Maschine und Außerirdische mit großer Geschwindigkeit über große Distanzen brachten.
Unvergessen das Licht in Kampf der Welten von 1953: Laserstrahlen, sprich Licht, wurden von bösartigen Außerirdischen auf die Erde abgefeuert und richteten Zerstörungen gigantischen Ausmaßes an. Licht als Schöpfungs- wie auch Zerstörungsmetapher gesteuert von überlegenem Geist.
Das Innere von Raumschiffen wurde erst durch massiven Einsatz von Licht futuristisch: Je mehr blinkende Lichter auf einer Brücke oder in einem Labor zu sehen waren, umso mehr Komplexität und technologisches Know-how konnte vermutet werden. Für den Zuschauer waren diese Zeichen übrigens so verständlich, dass sie nicht erklärt werden mussten: Das Urbild des Lichts als Wissensträger war und ist noch immer aktiv. Wie wäre man in den 50ern enttäuscht vom iPod gewesen …
Licht repräsentierte maschinelle Funktion und damit technische Fertigkeiten der Anderen, die die unsrigen übersteigen. Sie sind machtvoller als wir – uns versetzt es entweder in das Hoffen, die Fremden sind uns wohlgesinnt und setzen ihre überlegene Technik höchstens für uns statt gegen uns ein – oder in Furcht vor ihrer Bösartigkeit.
Licht ist in beiden Fällen vorhanden. Das gleißende Licht der Raumschiffe in „Independance Day“ ist Inbegriff weltweiter Vernichtung. Die hellen Lichter in Unheimliche Begegnung der dritten Art ist Verheißung, Hoffnung, Freundlichkeit.
In Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum erlangt Bowman durch einen wüsten Ritt durch Licht Erkenntnis, in strahlendweißen Räumen Unsterblichkeit und Wiedergeburt.
Und doch war es erst Spielberg, der in seiner Unheimlichen Begegnung das Licht massiv als Symbol über einen ganzen Film hindurch einsetzte. Dabei ließ er zunächst eine mögliche Deutung ins Unangenehme durchaus zu. Wenn die Außerirdischen im Film der Mutter ihren kleinen Sohn entreißen, ohne sie mit einzubeziehen, ist dies durchaus ein zunächst gewalttätiger Akt, ganz gleich, welche Wendung der Film letztlich nehmen wird.
Aber Licht wird hier in seiner ureigenen Form gezeigt: Als Stellvertreter für eine Macht, die wenn nicht Angst, so doch Verblüffung, Befremden auslöst. Das, was im Licht ist, beherrscht das Licht und damit auch „höhere Mächte“, und seien sie auch nur rein technologisch. Das Licht im Film kündet von Überlegenheit – und nicht nur auf technischem Gebiet. Die Lichtinszenierung in diesem Film lässt Heiliges durchdringen, etwas zutiefst Mythologisches. Die Menschen werden im Film magisch vom Licht angezogen, vom Wissen, angefacht durch Neugier. Und richtig: Durch das Licht werden die Menschen „wissend“, sie wissen, wenn auch zunächst unbewusst, vom späteren Landeplatz der Außerirdischen. Dass dieser Ort ausgerechnet „Devil’s Tower“ heißt, lässt sich durchaus deuten: Die Außerirdischen erhellen mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit die sprichwörtliche Dunkelheit der Menschen. Und deren Bösartigkeit, um sie zu vertreiben.
Spielberg ließ sich von den zahlreichen UFO-Sichtungen inspirieren, die fast alle in Dunkelheit stattfanden, in der Lichterscheinungen zu sehen waren: Mythologische Archetypen aus der Frühzeit der Menschen. Das Licht im Dunkel ist ihre Intelligenz in der Unterlegenheit der Menschheit, die noch viel zu lernen hat. Sonne, Mond und Sterne sind keine Götter mehr, auch der Olymp hat ausgedient. Die Götter kommen von den Sternen. Götter, auch wenn wir sie aufklärerisch „Wesen“ nennen, sind sie in gewisser Weise noch immer geblieben.
Das Licht repräsentiert sie. Spielberg war der erste, der sie entsprechend und bis heute stilbildend in Szene setzte. Das macht „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ zu einem Klassiker des modernen Films.
Wenn in Invasion vom Mars, gerade in der Neuverfilmung von 1986 die unheimlichen Lichtspiele zu sehen sind, ist dies nichts Anderes, nur unter anderen Vorzeichen.
Auch das „innere Licht“ oder „das innere Leuchten“ ist für beide Seiten besetzt worden: Wo das Herz von E.T. aus dem Inneren nach außen rot leuchtet und somit Verletzbarkeit zeigt, ist das rote Leuchten im Roboter Maximilian aus Das schwarze Loch zwar ebenso Zeichen von Intelligenz, jedoch bösartiger Natur.
In Filmen neueren Datums hat sich der Lichteinsatz verändert. So werden in Independance Day die Ausleuchtungen varriert: Das helle Licht der Zerstörung außen, die höhlenartige Düsternis des Bösen im Innern der Raumschiffe.
Heutzutage blinken keine Tausende bunte Lichter mehr – unsere Gegenwart hat dieses Zukunftsszenario längst getilgt. Stattdessen gibt es funktionale mehrfarbige Panels und Screens – oder schlicht strahlendweiße, nahezu sterile Orte. Heutzutage ist das vordergründige Fehlen von Technik Beweis für technische Überlegenheit.
Wie auch immer sich die Darstellung des Lichts in kommenden Filmen späterer Jahre auch verändern mag, so bleibt das Grundmuster ebenso gleich wie die intentionale Aufladung des Lichts. Licht als Zeichen ist uns in die Wiege gelegt, es ist Teil unserer Kultur. Ebenso die Hinwendung zum Göttlichen, in welchem Maßstab und welcher Ausprägung auch immer.
Denn auch wenn wir uns immer weiter entwickeln und eines Tages zu dem entwickeln könnten, was wir derzeit an gottgleichen Wesen in Filmen sehen, werden wir unseren kulturellen Anfängen auch weiterhin verbunden sein. Durch alle denkbaren Ausdrucksformen.
Dieser Artikel erschien im Magazin BWA 311 des Science-Fiction-Clubs Baden-Württemberg SFCBW.
Biedermeier to go
Krisen sind es, die zu Rückzügen führen. Raus aus der Welt, hinein ins Häusliche, Private, Überschaubare. Dort mag man finden, was abhanden kam: Sicherheit, Schutz, Kontrolle und Vertrauen in sich selbst und das eigene Leben. Und eine Zuflucht aus vorangegangen unsicheren Zeiten.
Biedermeier heißt eine Epoche des 19. Jahrhunderts und bezeichnet eine Abkehr von der großen weiten Welt zugunsten der Behaglichkeit des Zuhauses mit seinem Schutz und seiner Ruhe.
Doch auch heute stürzt sich der Einzelne bisweilen zurück in sein privates Biedermeier. Nicht selten wird da ein verlängertes Wochenende zu einer privaten Biedermeier-Zeit. Heutzutage hat das Ganze einen anderen Namen: Auszeit.
Dort ist nichts Neues zu finden – und gerade das ist auch ganz gut so.
Dem privaten Biedermeier geht ein Erschöpfungszustand oder ein Schmerz voraus, im Großen nach Finanzkrisen oder Kriegen, im Kleinen nach persönlichen Schrecken, Enttäuschungen, Peinlichkeiten oder einfach nur Überforderung, Erschlöpfung und Müdigkeit. Früher gab es dafür das schlne Wort Überdruss.
Alles ist ein Zustand einer Verletzung und eines Verlustet – die Zeit zum Ausheilen brauchen. Alles, was Wunden risse oder für weitere Unruhe sorgt, muss draußen bleiben. Man verkleinert damit notwendigerweise seinen Einfluss- wie auch Wirkungsbereich, schränkt sich wohlmöglich ein, kappt Kontakte, unterbricht oder beendet Verhältnisse.
Die hereinbrechende Stille ist kein Vakuum. Sondern vielmehr birgt sie eben das, was verloren ging: Vertrauen. Vertrauen in die Welt, in Menschen, in Zustände. Und vor allem Vertrauen in sich selbst und seine eigene Meinung und Ansicht.
Es ist Vertrauen, das verloren gegangen sein muss, um das Biedermeier aufblühen zu lassen. Und wenn es anbricht, wird es als heilsam, gar als schön empfunden. Es ist die Salbe und die Schmerztablette, der Verband und der Gips. Vertrauen wieder zu gewinnen ist nötig, denn ohne dies wäre ein Weitergehen, geschweige denn ein Weiterkommen nicht möglich. Das – übrigens gar nicht biedere – Biedermeier hilft dabei.
Im überschaubaren Raum, in den man sich zurückzieht, weiß man, womit man es zu tun hat. Nichts Unerwartetes oder Unvorhergesehenes erwartet einen, nichts droht, nichts schwelt, nichts kommt auf einen zu. Ein Gefühl wattierter Sicherheit, tröstend in seiner Wärme und Weichheit. Das Kappen der Sorgen, die man als öffentliche Person mit sich herumtragen mag, verschwinden langsam, und ihr Fehlen bietet mit der Zeit Erholung von dem, was zum Grund des Rückzugs wurde. Eines Tages mag der Schmerz oder Erschöpfung oder Überruss, die man erfahren hat, von selbst abklingen.
Vertrauen kann in Sekundenschnelle schwinden, der Aufbau erfolgt in kleinen Schritten. Man muss Geduld haben. Bis der Blick sich wieder hebt, bis die Gedanken nicht mehr bleischwer den Verstand vergiften, bis einfach der Schmerz nachlässt.
Gründe für Rückzüge gibt es viele. Von Überarbeitung über Stress bis zu Enttäuschung, Verlust, Demütigung oder Zweifel reichen sie, die eines gemeinsam haben: Es gab ein Zuviel von ihnen.
Dieses Zuviel überlastet die Schaltkreise der Maschine Mensch, deren Verstand eines Tages einfach blockiert oder deren Emotionen verrückt spielen, schlimmstenfalls eine Kombination beider Zustände. Am Zuviel zerbrechen sie und sehen nur noch in der Betulichkeit ihrer eigenen vier Wände Rettung. Rückzug ist immer eine Form der Depression. Bestenfalls eine relativ harmlose. Schlimmstenfalls nicht.
Rückzug ist nicht gleichbedeutend mit Rückschritt. Und er ist auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Auch als Epoche war das Biedermeier eine Übergangszeit, eine Reaktion auf Zeiten, die eine Restauration nötig machten. Somit geschah kulturgeschichtlich im Großen, was menschlich im Kleinen geschieht: Eine Renovierungsphase, eine Erneuerung.
Heutzutage ist das private Biedermeier nicht selten. Immer wieder wird man aus der Bahn geworfen, findet man auf die Bahn zurück. Freunde warten oder flüchten und fluchen, sehen Egoismus, mögen sich im Stich gelassen fühlen und mögen sich in ihr eigenes, individuelles Biedermeier zurückziehen. Jedenfalls abwenden vom Schlachtfeld. Doch nötig ist die Zeit dennoch, in der man dem erlittenen Schmerz oder Schock beim Abklingen nachspürt, bis man, eines Tages, das Fehlen des nachgelassenen Schmerzes nicht registriert.
Und das Biedermeier beendet.
Hemingwrite – die neue alte Art, zu schreiben
Nein, sie stirbt doch nicht aus: Die gute alte Schreibmaschine. Das beweist Hemingwrite, eine Schreibmaschine, die – natürlich – auch noch mehr ist. Hemingwrite überträgt die Funktionalität einer alten Schreibmaschine in die heutige Zeit, so dass ein kleiner papierweißer Monitor als Papierersatz dient. Und selbstverständlich muss und kann man die Texte elektronisch speichern. Doch interessant machen Hemingwrite nicht die technischen Features, sondern vielmehr das Konzept des Schreibens, das dahintersteckt. Denn Hemingwirte besinnt und reduziert sich.
Der Begriff „retro“, der auch Hemingrwite anhaftet, reicht bei Weitem nicht aus.
Es geht um das Schreiben an sich, um die Natur des Verfassens. Sie gedeiht eben nicht in der Fülle von Funktionen und technischer Finessen, sondern dort, wo von Technik und Bedienung eben keine Rede mehr ist.
Wie ich erst kürzlich in einem Blogartikel schrieb, sind Schreibende inzwischen nicht nur von Tools umgeben, sondern von Diskussionen über deren Bedienung – Tekkies kapern alle Bereiche, wo sie oft nicht hingehören. So wundert es nicht, dass erstaunlich viele Schreibende wie Blogger, Texter, Journalisten oder Schriftsteller, nach wie vor auf das vollkommen analoge Notizbuch schwören.
Das Analoge ins Digitale zu bringen, ist ein Verdienst von Hemingwirte: Technik für den Einsatz, nicht den Einsatz für die Technik. Eine Reduzierung auf ein Wesentliches, das sich langsam wieder selbst wahrnimmt im Wust der Anwendungen.
Technik macht es vermeintlich einfach: Indem sie einem vorgaukelt, man habe etwas erreicht, wenn man sie beherrscht, wiegt sie einen in trügerischer Sicherheit. Dabei ist Schreibenden die verwendete Technik in erster Linie einmal egal. Sollte es auch, denn sie schreiben. Und ein versierter Benutzer eines Programms kann beim Schreiben nach wie vor ein untalentierter Depp sein.
Diese Wahrnehmung der eigentlichen Kompetenz und des initialen Wesens dessen, was man tun will, ist wichtiger als je zuvor. Denn es richtet sich wieder dem zu, was man eigentlich tun will und nicht, wie man es tun will. Das ist nicht nur eine Konzentration, sondern eine bewusste Ausklammerung von Störfeuer – die Vermeidung von Zeitverschwendung also.
Mit Heminwrite ist also nichts anderen als das Schreiben und das Festhalten des Geschriebenen möglich – nur statt auf Papier digital.
Das ist zu schön, um wahr zu sein? Leider ja: Denn Hemingrwite ist zunächst nicht mehr als Konzept, dem noch kein verfügbares Produkt folgt.
Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das Team von Hemingrwite jedenfalls macht über Website, Blog und soziale Medien einiges, um auf ihr Projekt aufmerksam zu machen – das ist schon einmal geglückt, denn immer mehr Medien und Blogs befassen sich mit Hemingwrite.
So ist zu hoffen, dass eines Tages die Rückkehr zur guten alten – und doch ganz neuen – Schreibmaschine mit ihren Tugenden der Redutkion mehr sein wird als ein frommer Wunsch.
Schreiben und Werkzeuge
Wie den neuen Roman schreiben? Die Frage klingt einfacher, als sie ist – und eben das ist das Absurde an ihr. Denn ich stelle mir derzeit diese Frage eher mit dem Blick auf das ideale Tool. Da haben wir das absurde Wort: Tool. Mit dem Schreiben verhält es sich normalerweise so: Man hat einen Stoff und man schreibt. Mit der Tastatur, der Schreibmaschine, der Hand. In der Regel sind dies einfache Entscheidungen. Die Wahl eines Textverarbeitungsprogramms stellt sich noch. Aber auch dies ist eher kein Hindernis für das Schreiben an sich, und mal ehrlich, wir wollen doch genau das: Schreiben. Arbeiten mit Stoffen, Motiven, Charakteren. An Techniken des Schreibens feilen.
Und jetzt? Stolperte ich über die Frage, ob ein Programm wie Scrivener etwas für mich sei. Man liest ja viel darüber. Und ja, es klingt schon gut, so professionell. Was man damit alles tun kann. Eine Gratis-Testversion ist zudem auch nicht weit.
Womit ich zu meiner Frage komme: Ist es nicht lästig, sich damit zu befassen, mit welchem Programm man schreibt? Hindert es nicht am eigentlichen Schreiben, am eigentlichen Erarbeiten einer Story, eines Inhalts?
Nichts gegen Scrivener, auch wenn ich es letztlich nicht verwenden werde. Aber ich spürte recht schnell, dass mich das Beschäftigen mit dem Tool vom Eigentlichen ablenkte, dass sich mein Fokus verschob weg vom Schreiben hin zum Bedienen – und gibt es nichts Unmündigeres, Schlimmeres, als lediglich ein Bediener von etwas zu sein?
Während ich mich also mit Scrivener zu beschäftigen begann und ich mich durchklickte, im Internet nach deutschsprachigen Anleitungen suchte (fast hätte ich wie selbstverständlich „Tutorials“ geschrieben) und versuchte, mich einzufinden, stellte ich für mich fest: Nein. Nein, ich will das nicht. Es war und ist mir zu umständlich, mich mit einem Instrument zu beschäftigen. Ich wollte all die Dinge auch gar nicht lesen, die andere über das Programm geschrieben haben. Keine Hinweise suchen, dass und ob und wie das Programm für mich sinnvoll sein könnte.
Noch etwas fiel mir auf: Wie sehr und wie viel mittlerweile darüber geschrieben wird, wie man ein Programm ZUM Schreiben bedient. Statt darüber zu schreiben WIE man SCHREIBT. Vieles liest sich mittlerweile nur noch wie technische Beschreibungen von etwas, von dem ich das dumpfe Gefühl habe, dass es mit dem Schreiben an sich gar nichts zu tun hat.
Was mich zur Frage brachte: Muss man denn eigentlich zwangsläufig hinterfragen, ob die Art und das Programm, mit der und mit dem man arbeitet, überhaupt heutzutage noch zeitgemäß ist? Muss man sich hinterfragen, ob man nicht doch einmal etwas Neues ausprobieren sollte? Und zuletzt: Muss man das Gefühl haben, dass ein anderes, neues, professionelles Werkzeug aus einem einen besseren Schreiber macht und bessere Texte ermöglicht? Dann ist doch das Hinterherjagen danach eher eine Illusion, eine Kanalisierung der Beschäftigung damit, wie man sich selbst als Schreiber wahrnimmt und wie man zu seinen Texten und seiner Arbeit damit steht. Es wäre doch ein Irrglaube, dass ein Programm uns besser macht, und was soll überhaupt dieser Wesenszug, sich immer nicht nur zu hinterfragen, sondern wie selbstverständlich als unkomplett anzusehen und uns deshalb auf die Suche nach etwas zu begeben, was uns besser, klüger, kurz: kompletter macht?
Ganz sicher mag Scrivener ein ausgezeichnetes Werkzeug sein, das auch berechtigterweise viele Anwender gefunden hat. Dennoch steht die Frage im Raum, ob die generelle Auseinandersetzung mit neuen Tools nicht eher das eigentlich Schreiben stört, weil es ablenkt und Energie auf ein dumpfes Bedienen von etwas lenkt. Und ob es letztlich nützt. Zum Schluss bleibt nur die Antwort, die man für sich selbst findet, und ich habe meine gefunden. Sie lautet ganz einfach: Nein.
Zum 25. Jubiläum des Mauerfalls steht sie wieder im Raum, die Frage: Darf man die DDR einen Unrechtsstaat nennen? Oder geht dieser Begriff an der damaligen Realität vorbei? Eine geschmacklose Diskussion. Denn die Tendenz, das Wort Unrechtsstaat nicht zu verwenden, ist fatal. Wir brauchen Worte. Worte, die auch unmissverständlich deutlich sind. Worte, die Dinge und Zustände benennen.
Wir müssen uns der Bedeutung und der Geschichte dieser Begriffe sicher sein – da schaden Umdeutungen und Infragestellungen wie Hinweise darauf, dass Die Bevölkerung der DDR selbst nicht an Unrecht beteiligt war und der Begriff des Unrechtsstaats sie jedoch schuldig mache.
An Punkten wie diesen wird derlei Gebaren viel mehr als eine sprachliche Fingerübung, sondern sie wird zur Verfälschung der Wahrheit. Wer Begriffe umdeutet und verfälscht, fördert die Verwirrung und eröffnet Diskussionen rein um ihrer selbst willen.
So auch hier: Wer leugnet, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, wendet sich mit dieser Einstellung gegen das Volk der ehemaligen DDR und redet die Tendenzen klein, die ein solcher Begriff eigentlich nachhaltig zu verhindern versucht. Es ist die Aufgabe eines Begriffes wie Unrechtsstaat, das Andenken an Unrecht, Leid und Unterdrückung aufrechtzuerhalten.
Schließlich war es das Unrecht der Staatsobrigkeit dem eigenen Volk gegenüber, es war der größte Überwachungsapparat der Menschheitsgeschichte, es waren die Gefängnisse und Verurteilungen und die Mauertoten, die den Titel Unrechtsstaat erst möglich gemacht haben.
Ein Staat, der sich auf diese Weise seinem Volk gegenüber verhält, es unterdrückt und sich zum Feind macht, betreibt Unrecht. Tag für Tag.
Dies nun damit ausgleichen zu wollen, dass das Volk selbst am Unrecht nicht beteiligt war und es auch viel Normalität im Zwischenmenschlichen gab, höhlt Wahrheit aus.
In gewissem Sinne sind Begriffe Mahnmale – und die sollte man nicht beschönigen oder umdeuten. Sonst vergreift man sich an Geschichte und Wahrheit.
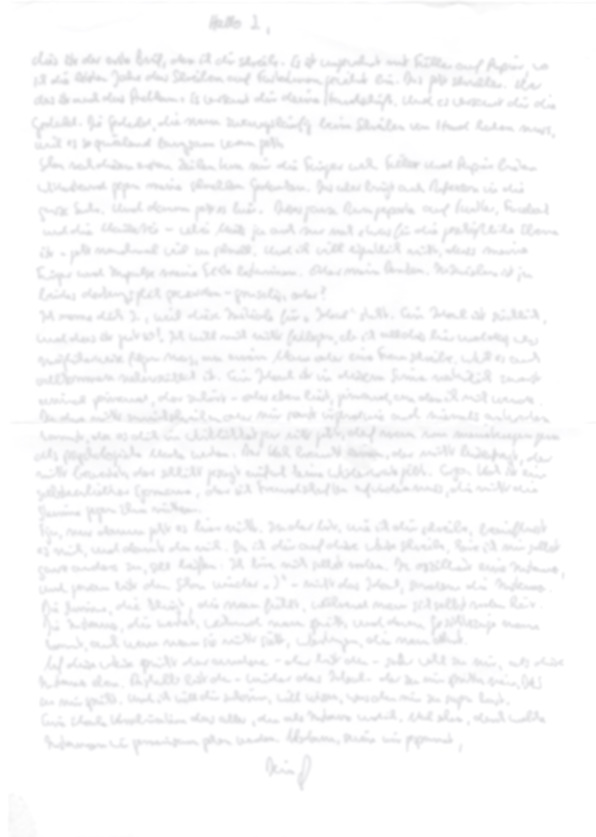 Der erste meiner Hallo I Briefe, meinem Schriftwechsel mit einer fiktiven Person. Über den Schriftwechsel habe ich hier geschrieben, wo ich auch diesen hier zu lesenden Brief im handschriftlichen Original einmal abgebildet habe. Hier nun der erste Brief an I: Keep Reading
Der erste meiner Hallo I Briefe, meinem Schriftwechsel mit einer fiktiven Person. Über den Schriftwechsel habe ich hier geschrieben, wo ich auch diesen hier zu lesenden Brief im handschriftlichen Original einmal abgebildet habe. Hier nun der erste Brief an I: Keep Reading