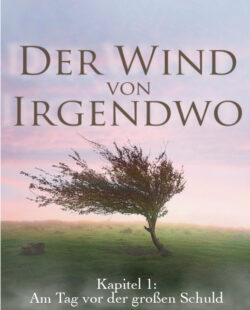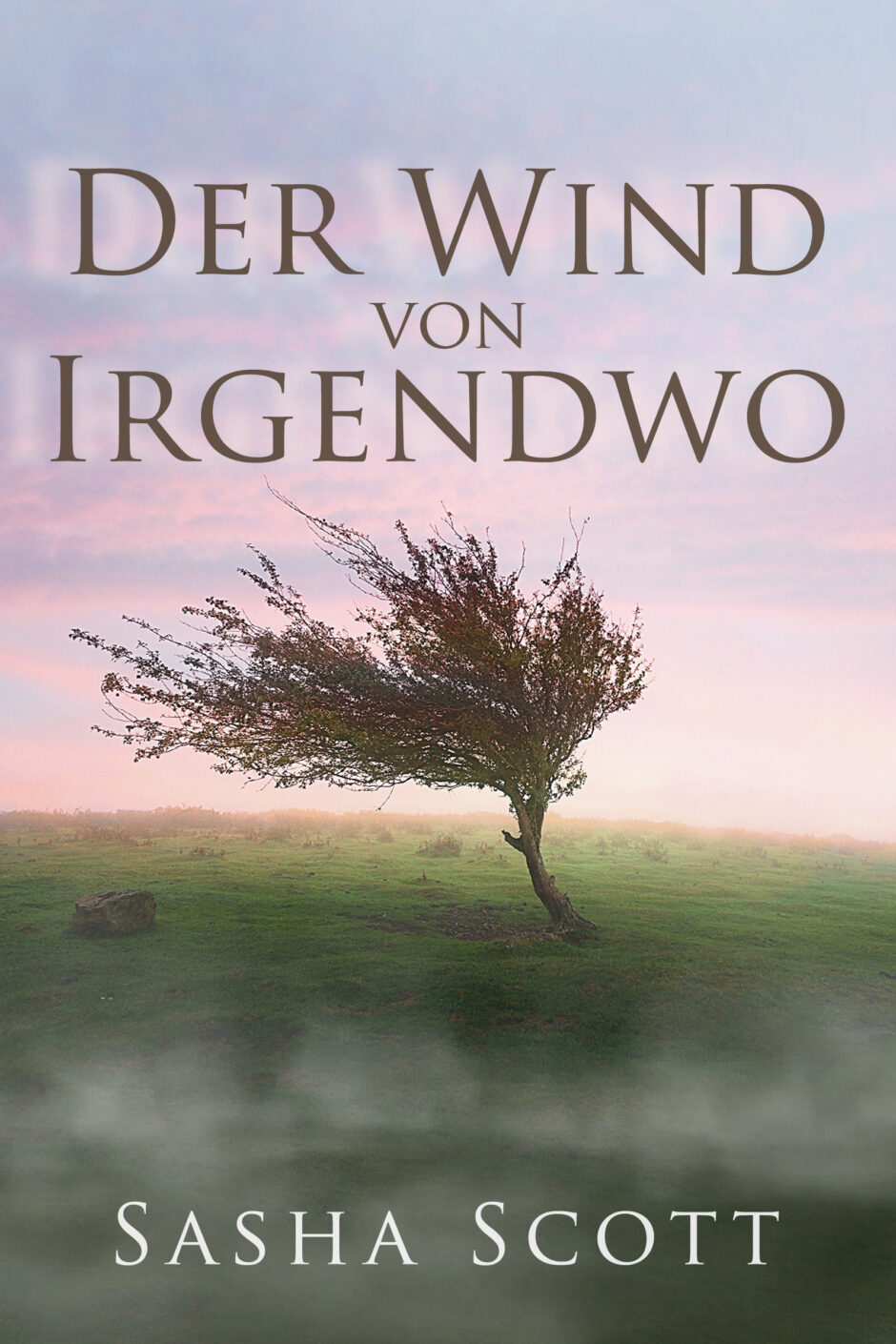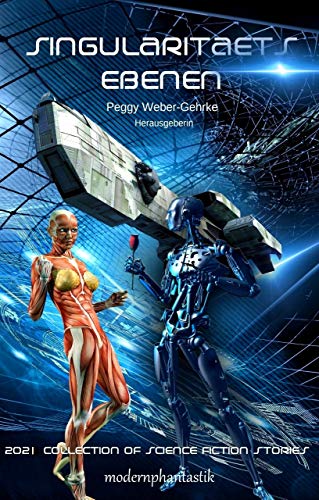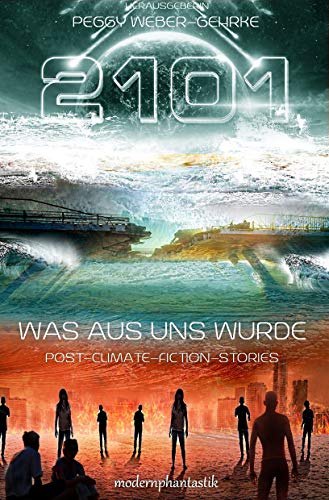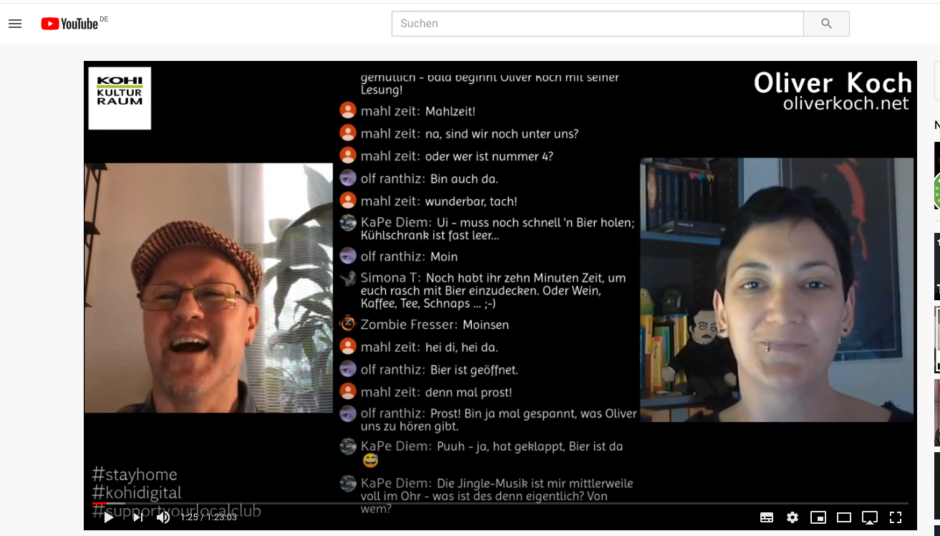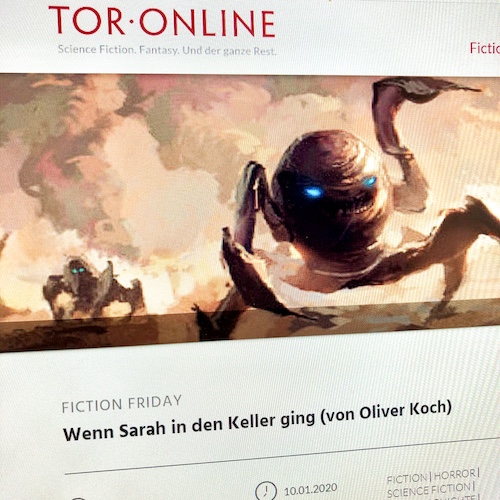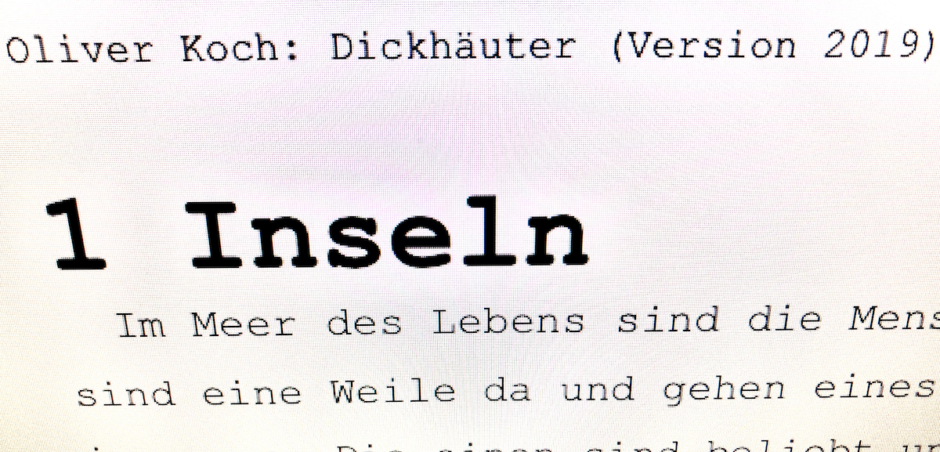Mystery-Roman von Oliver Koch
Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesen
Erst Kapitel 2 lesen
Jessica war gespannt auf das, was kommen sollte.
Nicht, dass es das große Ereignis war, das immer näher rückte. Das Feldfrucht-Fest war ein Fest zu Ehren dessen, das den Menschen des Dorfes die Dinge gab, die sie benötigten. Das waren Lebensmittel, Holz zum Bauen, Nutztiere, die Gunst des Wetters, auf dass die Früchte der Felder und Bäume und Sträucher gut und erntereich gediehen. Die Menschen hatten keine Vorstellung von dem, was Gott war oder sein sollte. Sie beteten die Natur an und ihre Dinge. Sie zu erfassen, überstieg die Denkweise der Menschen des Dorfes, wäre da nicht immer eine Frau gewesen, die von sich behauptete, Wahrsagerin zu sein, eine Weise, eine Allwissende fast, die die Sterne zu deuten verstand und die in der Lage war, längst Vergangenes und gerade Geschehenes zu einer Zukunftsdeutung zu verbinden. Somit besaß Tirata, die Wahrsagerin, einen hohen Stellenwert im Dorf.
Sie war weise und gefürchtet. Jeder achtete sie in einer Art und Weise, die vergötternder Furcht gleichkam. Man erzählte sich, dass Tirata einem anderen Geschlecht abstammte, das es im Dorf sonst nicht gab. Einmal im Leben einer Wahrsagerin wurde ein junger Mann aus dem Dorf ausgewählt, um mit ihr ein Kind zu zeugen, und, so wundersam es auch erschien, es waren immer Töchter. Kam es zu einer Totgeburt, wurde ein neuer Mann auserkoren, bis eine Tochter das Licht der Welt erblickte. Aus diesen Mädchen erwuchs stets eine neue Wahrsagerin, die die Anlagen von etwas Nichtirdischem innehatte, Markenzeichen sowohl innerer, als auch äußerer Art, die sie von dem normal Menschlichen abhob.
Sie als Zukunftsdeuterin und Wunderheilerin, die das ganze Dorf beeinflusste und auf gewisse Weise leitete, nicht darin, sondern weitab davon einsam wohnte, hatte jedem Ereignis wie Geburt, Tod, Heirat oder großen Festen mit ein paar Worten das entsprechende Quantum Heiligkeit zu verleihen. Wenn sie sprach, schwiegen gar die Vögel, und was sie sprach, ließ keinen Zweifel offen: Sie wusste als Einzige über das Rätselhafte, das in allem steckte, Bescheid.
So sollte sie auch nun ein paar Worte sprechen, um das Feldfrucht-Fest zu segnen und seine Bestimmung deutlich zu machen. Zu diesem Zweck war es diesmal Lorn, Tirata im Namen des Dorfs zu bitten, das Dorf zu besuchen. Jessica hatte mitgehen wollen, obgleich sie sich vor Tirata fürchtete. Es war der merkwürdige Zug des Menschen, an dem Schrecklichen das Schöne zu finden.
Jessica sah Tirata nicht oft. Bei jedem Fest tauchte sie auf und hielt sich vielleicht eine Stunde bei der Dorfbevölkerung auf, bevor sie sich entschuldigte. Einmal hatte Jessica einer Geburt beiwohnen dürfen, bei der sie auch Tirata gesehen hatte. Und bei einer Beerdigung hatte sie sie einmal gesehen – und öfter hatte sie sie niemals zu Gesicht bekommen.
All die anderen Gesichter des Dorfes sah man jeden Tag gleich mehrere Male, und wenn nicht, dann war das am Rande des Merkwürdigen.
Tirata hingegen war eine Sensation. Manchmal sah man sie aus der Ferne, wenn die in Richtung Corrin-Höhle ging, um dort für einige Stunden zu verschwinden. Niemand sonst traute sich in die Corrin-Höhle, und nach dem, was Tirata erzählte, würde dies niemand außer ihr tun. »Die Geister der Vergangenheit sprechen in dieser Höhle«, meinte sie einmal.
Niemand stellte das in Frage, und niemand dachte daran, das nachzuprüfen. Wer es wagte, wurde verrückt, oder kehrte niemals wieder – von solchen Fällen berichtete man.
Tiratas Haus lag etwa einen Kilometer außerhalb des Dorfes inmitten einer weiten Weide, und es wurde von den Wellen des grünen Ozeans umspült. Im Sommer flog die Gischt der Samen an die Wände, und einige Bäume um das Haus ließen den Wind zu einer hörbaren Stimme werden.
Es war still und heiß, als Lorn mit Jessica in Richtung Tiratas Haus ging. Sie hatte ihre kleine Hand in die große, schweißnasse Hand ihres Vaters geschoben, die sie festhielt. Der Wind rauschte durch das hohe, dichte, saftige Gras, und der Himmel war azurblau, von tiefster Schönheit, und einige Vögel jagten über ihn hinweg. Zu ihrer Linken türmte sich das Gebirge auf, mit dem tiefen Schlund der bösen Corrin-Höhle irgendwo im Gestein. Niemand sagte ein Wort. Sie hörten ihre raschelnden Schritte, sie hörten die Vögel, ansonsten hörten sie nichts. Sie sahen sich nicht zum Dorf um, wo es geschäftig zuging, und wo jeder, mit Ausnahme von Alba, der Frau vom Schmied, die über eine böse Magenverstimmung klagte, auf den Beinen war. Sie hatten alles hinter sich gelassen und schauten nur nach vorn auf das Haus von Tirata, dieser Hütte umgeben von Bäumen und Grün, dessen Dachholz allmählich brüchig wurde, und durch das es durchregnen musste.
Wer einmal in das Haus kam, war bald ebenso eine Sensation wie alles, was auch nur weit entfernt mit dieser Frau zu tun hatte. Lorn hatte diesmal die Ehre bekommen, wobei Ehre nur dazu missbraucht wurde, den Menschen des Dorfs nur einmal im Leben diese Aufgabe aufzubürden.
»Hast du eigentlich Angst, Pepe?«, fragte Jessica leise in den Wind hinein.
»Nicht doch«, antwortete Lorn viel zu leise. Denn ja, er hatte Angst. Er wusste, dass Tirata nichts Böses tat, dass sie nicht einmal böse war, doch die Ehrfurcht ließ ihn fürchten. Er presste Jessicas kleine Hand.
»Aua, du tust mir weh«, meinte Jessica und versuchte, die Hand ihm zu entreißen.
»Oh, entschuldige, Kleines«, meinte er verstört und ließ sie los, um sich daraufhin seine Hände zu reiben, mit denen er eben noch in Litern von Blut des Schlachtviehs gesuhlt hatte, die Eingeweide und Organe herausgenommen und den Tieren zum Fraß vorgeworfen hatte.
»Ich glaube, Tirata tut nichts Böses, Pepe. Sie ist unheimlich, aber richtige Angst habe ich auf einmal gar nicht mehr vor ihr. Sie ist sicher nur alt und lieb.«
»Sie ist alt, aber lieb ist sie nicht. Nein, sie ist nicht böse, und sie tut auch niemandem etwas, aber sie ist nicht lieb, ganz sicher nicht. Sie kann viel Böses tun.«
»Kann sie die Leute verwandeln?«
»Ja, das kann sie.«
»Kann sie die Menschen verschwinden lassen?«
»Ja, das kann sie.«
»Kann sie den Menschen Angst in die Träume bringen?«
Lorn schüttelte es. »Ja, das kann sie.«
Das Haus war näher gekommen, und sie erreichten die Skelettfinger der Bäume, die es umrandeten. Jessica sah zu ihnen auf und ließ den Blick auf den Raben in den Wipfeln haften.
»Was sind das für Bäume, Pepe?«
»Ich weiß es nicht, Jessica. Sie stehen jedenfalls nur hier.«
»Du hast Angst, das merke ich. Du hast Angst. Warum hast du Angst, Pepe?«
»Weil man vor Tirata immer Angst hat. Und weil sie merkt, wenn du keine vor ihr hast und sie dann böse wird.«
»Will sie denn, dass man sie fürchtet?«
»Jeder fürchtet sie.«
»Ist das ein Grund, Pepe?«, wollte sie wissen und sah zu ihm auf, blieb stehen und wartete, bis auch er ein paar Schritte später stehengeblieben war und sich nach ihr umsah. Der Wind rauschte um sie beide. »Wenn alle Angst vor ihr haben, muss das einen Grund haben. Sie kann Böses tun.«
»Das glaube ich nicht.«
»Sie ist mächtig und geht in die Corrin-Höhle. Sie ist mit den Geistern dort in Verbindung.«
»Na und? Und was ist, wenn die Geister gar nicht böse sind?«
»Sie sagte es uns aber, Jessica, und willst du sagen, dass sie gelogen hat?«
»Nein. Dann wird es wohl so sein.« Sie schritt zu ihrem Vater und ergriff seine Hand. Seltsamerweise hatte sie nun wirklich keine Angst mehr vor der Frau. Vielmehr war sie neugierig, sie zu sehen, sie zu begrüßen und sie allerlei Dinge zu fragen, auf die sie sich Antworten erhoffte. Und dann war sie wenigstens ein bisschen so mächtig wie Tirata.
Ehrfurcht hatte sie. Bewunderung, auch – aber Furcht? Nein. Warum auch? Die Frau hatte ihr nie etwas getan, und sie konnte sich auch nicht an irgendeine der vielen Geschichten erinnern, die man sich am Lagerfeuer erzählte, in denen auch nur einmal andeutungsweise eine böse Tat oder Absicht vorgekommen wäre.
Das Haus, in dem die Wahrsagerin wohnte, war älter als alle, die Jessica aus dem Dorf kannte, und der Wind flüsterte unverständliche Geschichten durch die Ritzen des Hauses und durch die Wipfel der Bäume. Lorns Knie waren weich, er zitterte am ganzen Körper, und trotz der Wärme war ihm kalt. Wann hatte er Tirata jemals so aus der Nähe gesehen? Er konnte sich an ein Mal erinnern, aber das war Jahre her und er wäre auch beinahe gestorben vor Angst. Diese erhabene Gestalt der Frau, die schon damals alt war und nun noch viel älter, und die nie sterben zu wollen schien, ihre langen, grauen Haare, ihre schnarrende Stimme, ihre Vorhersagen, die sie getroffen hatte und die eingetreten waren. Und nun sollte er sich ansprechen. An ihre Tür des Hauses klopfen, das er immer gemieden hatte. Er hatte es immer nur aus der Entfernung gesehen, von sich zu Hause, von den Feldern. Immer hatte es einsam und still dagelegen wie ein Felsbrocken im Gras, manchmal hatte er Tirata gesehen, wenn sie nach draußen kam und in ihrem Garten Gemüse und Kräuter holte, wie sie Wasser schöpfte oder wie sie gar ihre Tiere schlachtete. Das tat sonst keine Frau.
Sein Herz raste, als er vor der Tür Halt machte. Er sah an sich herab, begutachtete seine Kleidung, denn er wollte nicht ungepflegt erscheinen, kurzum, er wollte ihrer würdig erscheinen. Mit einem Anflug von zusammengefasstem Mut räusperte er sich und klopfte gegen die Tür. Was wollte er sagen? Wie sollte er es sagen? Sollte er wieder gehen, schnell und heimlich, sich durchs kniehohe Gras ungesehen davonschleichen und im Dorf sagen, er hätte es sich nicht getraut?
Welch Blamage!
Da öffnete sich die Tür.
Lorn stand da und das Herz wollte ihm stehenbleiben, ein Schlag von unerträglicher Hitze überwallte ihn.
Da stand er Tirata gegenüber, und er hatte einen grässlich trockenen Mund.
Wie sie dastand und ihn ansah mit ihren dunklen, geheimnisvollen Augen. Sie trug bunte Schnüre in ihrem langen Haar, das grau war wie altes Holz, und ihre Falten schlugen Täler in die fremde Landschaft ihres Gesichts.
Es hatte ihm die Sprache verschlagen, und der Wind wehte um sie herum, Luft aus dem Innern dieses merkwürdigen, gemiedenen Hauses stieg ihm in die Nase. Sie roch süßlich und ließ ihn schwindelig werden.
Tirata blickte ernst wie immer; man sah sie nie lachen. Sie blickte ihn an und schien darauf zu warten, dass er etwas sagte, und da er es nicht tat, blickte sie nach unten und erblickte dieses reizende Mädchen, das da neben Lorn stand und zu ihr aufblickte mit großen Augen und keiner Spur von Angst darin.
»Oh, kleine Dame, bist du nicht die kleine Jessica?«, fragte die Wahrsagerin mit tiefer, brüchiger Stimme, die schon oft am abendlichen Feuer beschwörend in die Runde getragen worden war.
Für Jessica eröffnete sich etwas Neues, und sie war in der Lage, wenngleich auch leise, zu antworten: »Ja, das bin ich.«
»Jessica«, wiederholte Tirata geheimnisvoll und wiegte den Namen in ihrem Mund, aus dem so manch Rätselhaftes kam. »Jessica. Jessica. Ein schöner Name, dieser Name.« Sie zeigte beiläufig mit der linken Hand auf Lorn, ohne ihn anzusehen. »Hat er ihn dir gegeben?«
Jessica nickte nur.
»Wie kam es? Kann er schreiben, dass er ihn aufgeschrieben hat, oder kann er tatsächlich sprechen und tut das nur nicht mit jedem?«
»Er hat Angst vor dir«, erklärte Jessica freimütig und spürte, wie Lorns Hand sich strafend fest um die ihre drückte.
Da sah Tirata an und durchbohrte ihn förmlich mit einem stechenden Blick. »Dann bist du Lorn, richtig?«
Ein heißer Schauer überlief ihn, und mit weit aufgerissenen Augen nickte er nur verängstigt die Andeutung eines Nickens.
»Soso. Du hast eine kluge Tochter. Bewundernswert. Soll ich sie fragen, weswegen du angeklopft hast?«
Tausend Möglichkeiten rasten durch Lorns Kopf, wie er es anfangen konnte, Tirata zum Fest einzuladen, doch ihm fiel keine ein. Keine der tausend Möglichkeiten war einer Meinung nach die richtige.
»Kommt erst einmal herein, es ist ziemlich windig heute.«
Sie schritt zur Seite und bedeutete so, dass die beiden hereinkommen sollten.
Jessicas erster Impuls war, einen Schritt nach vorn zu machen, doch plötzlich wurde sie der Tatsache gewahr, dass Lorn noch ihre Hand hielt und noch keinen Zentimeter von der Türschwelle gewichen war.
Für ihn war dies eine zweite Corrin-Höhle, in der es umging, in der Dämonen lebten, in der böse Dinge geschahen, die seinen Horizont überstiegen. Er sah nur die Einrichtungsgegenstände und erschauerte. Sie hatte eine viel größere Feuerstelle als alle anderen im Dorf, an den wenigen Fenstern hingen Stoffe, die das Sonnenlicht milderten und den ganzen Innenraum in ein schummriges, fremdes Licht tauchten; ein Feuer brannte in der Ecke links voraus von ihm, und das Knistern war so gespenstisch, dass es kein normales Holz sein konnte, das da brannte. Es roch nach Feuer und nach etwas Süßlichem, das er nicht deuten konnte. Er sah kein Bett, wohl aber wallenden Stoff, der von der Decke herabhing und etwas verbarg. Auf einem Holztisch lagen bunte Steine, ein kleines Säckchen lag daneben. In Tassen war Wachs, und er sah einige Bücher, von denen er nur wusste, dass in ihnen Geheimnisse standen.
Dies war kein normales Haus, dies war somit kein Heim einer normalen Frau. Nicht, dass sie eine Hexe war. Aber sie war schrecklich. Sie sah schrecklich aus, sie hatte eine schreckliche Stimme, sie hatte Schreckliches in ihrem Haus, und selbst das war schrecklich, weil es bald zusammenfiel.
»Komm, Lorn, tritt ein. Ich werde dir die Zukunft sagen.«
Lorn konnte nicht, und jede Faser in ihm wehrte sich dagegen. Jessica stand nach wie vor da und zog ihn ein wenig mit ihrer spärlichen kindlichen Kraft.
Tirata sah ihn böse an. »Willst du deiner Tochter meine Gunst verwehren, Lorn?«
Das genügte. Ihre Gunst nicht innezuhaben hieß, von bösen Träumen geplagt zu werden. Das sollte nun auf seine kleine Tochter zukommen, einzig und allein durch seine anscheinend nicht überwindbare Feigheit? Langsam tat er einen Schritt und noch einen in die zweite Corrin-Höhle, obgleich alles in ihm dagegen revoltierte.
Tirata schloss hinter ihm die Tür und ging um sie herum. »Hast du Durst, Jessica? Ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Nur ich weiß, wie man es zubereitet, wie ich so vieles als Einzige weiß in diesem Dorf.«
Jessica nickte stumm und sah sich um. Wie hübsch es hier war. Die bunten Steine waren lustig, der Stoff, der überall hing, war in einer Weise romantisch, dass sie auf die Bezeichnung romantisch nie gekommen wäre; es gefiel ihr einfach. Das brennende Holz roch eigenartig, aber es roch gut und erfüllte das Haus. Sie schritt im Raum herum und sah die vielen Töpfe, Pfannen, Löffel und Stäbe, die in der Küche hingen. Niemand sonst hatte so viel Töpfe und Pfannen und Löffel und Stäbe.
Die alte Frau betrachtete sie und bemerkte ihr Interesse daran. »Habt ihr Zuhause nicht so viele Dinge zu Kochen?«
»Nein. Was machst du nur damit?«
»Viele Dinge. Viele Rezepte, die nur ich weiß. Sie stehen in den Büchern da.«
»Du weißt, was darin steht?«
»Natürlich weiß ich das. Meine Mutter hat es mir schon vor langer Zeit beigebracht, und meine Großmutter hat es meiner Mutter beigebracht. Meine Urgroßmutter meiner Großmutter, und so weiter.«
»Und sind das merkwürdige Sachen, die du kochst?«
»Merkwürdig nur, weil niemand sonst sie kennt. Und nur ich esse sie, mein Kind.«
Lorn stützte sich an einem Stuhl ab und nahm seinen ganzen Mut zusammen, er räusperte sich und formte einen Satz, als Tirata ihn ansah. »Oh, Lorn, möchtest du mir etwas sagen? Ich nehme es an, denn du bist bestimmt nicht gekommen, um mir nur guten Tag zu sagen, da du ja nicht einmal das getan hast.«
Das Blut raste durch Lorns Adern, und er spürte, wie er puterrot wurde. »Ich … bin gekommen, um …ähem …«, und er räusperte sich wieder unbeholfen.
Tirata stand mit Jessica in einigen Metern Entfernung und sah ihn geduldig an. »Weswegen bist du gekommen, Lorn?«
»Heute ist der Tag des … Festes, und ich bin gekommen, um dich zu bitten, dass du ein paar Worte sprichst.«
»Was soll ich denn sagen, Lorn?«
»Das … musst du wissen, Wahrsagerin. Heute ist das Feldfrucht-Fest.«
»Ich weiß, ich weiß, Lorn. Ich danke dir für die Einladung, und selbstverständlich werde ich kommen. Setz dich. Möchtest auch du etwas von meinem Getränk, das niemand außer mir kennt? Deine Tochter ist angetan davon. Setz dich endlich hin. Auf den Stuhl da.«
Lorn setzte sich und war wie vor den Kopf geschlagen. Eigentlich hatte er nun gehen wollen, schnell, schnell zurück ins Dorf und vielleicht noch ein, zwei Schweine schlachten. Holz hacken. Mähen. Vielleicht den Frauen und Kindern beim Beerenpflücken helfen. Ganz gleich, nur raus hier aus diesem schrecklichen Haus.
»Du scheinst über deine Ehre, mich diesmal einladen zu dürfen, nicht besonders glücklich zu sein, Lorn.«
Er sagte nichts und sah betreten zu Boden.
»Er hat einfach nur schreckliche Angst«, platzte Jessica heraus. »Ganz schreckliche Angst.«
»Die Angst vor Wissen und Macht ist immer ratsam, Kind.«
Lorn wurde plötzlich schlecht und er sah seine Befürchtungen bestätigt.
»Bist du denn wirklich so mächtig?«
»Jessica«, tönte es kleinlaut vom anderen Ende des Raumes, wo Lorn saß und sich schlecht fühlte. »Wie kannst du es wagen, so eine Frage zu stellen? Natürlich ist sie das. Tirata, verzeih, aber ich habe ihr das nicht …«
»Ist gut, Lorn, ist schon gut. Ich werde dich nicht strafen. Du bist ein guter Mann, und ich habe keinen Grund, dir etwas tun zu wollen. Habe du nur weiter Angst vor mir, Angst ist immer gesünder als Vertrauen. Ein Hase traut auch keinem Wolf über den Weg. Also bleib du ruhig der Hase und sieh mich weiter als Wolf, wenn du willst. Deine Tochter fragt ganz Natürliches. Nur fragt mich das sonst niemand.« Sie sah zu Jessica herunter und hielt ihr Kinn mit kalten, dürren Fingern. »Jessica«, begann sie leise und fuhr ebenso fort, »es gibt viele Geheimnisse um uns. Der Wind spricht. Die Corrin-Höhle ist seltsam, und Geister gibt es überall. Das Mächtige ist um uns, Kind. Wir sind ihm unterlegen. Ich gehöre einem Geschlecht an, das die Aufgabe hat, zumindest ein wenig mehr darüber zu erfahren. Ein wenig mehr zu wissen als die anderen. Weil ich auch mehr wage. Ich gehe in die Corrin-Höhle, ich höre den seltsamen Stimmen zu, die überall wispern. Und ich glaube, etwas ist in mir, das mir die Gabe gibt, mehr zu verstehen als ihr. Und so bin ich für euch da, um euch zu helfen.«
»Auch, uns zu strafen?«
Tirata sah auf und ging zu einem Tisch, auf dem ein Krug stand. »Hier, Kind, trink das. Es wird dir guttun. Du auch, Lorn?«
Lorn schüttelte den Kopf.
Tirata goss etwas in einen Becher und reichte ihn Jessica. »Trink, Kind, es ist eine Spezialität, kein geheimnisvolles Gift, keine mystische Essenz. Deiner Tochter werden schon keine neuen Köpfe wachsen.«
Lorn fand das gar nicht komisch und fragte recht brüsk: »Können wir dann gehen, wenn meine Tochter getrunken hat?«
Tirata sah ihn lächelnd an. »Aber natürlich, Lorn, natürlich.«
„Der Wind von Irgendwo“ geht weiter mit Kapitel 4: Maraim und die Frösche am Sonntag, 10. April 2021