Mystery-Roman von Oliver Koch
Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesen
Erst Kapitel 12 lesen
Als Mark erwachte, war es bereits früher Tag, und blinzelnd öffnete er die Augen. Die Sonne verbarg sich hinter einer hellgrauen Wolkendecke. Er bemerkte, dass Tsam nicht mehr im Bett lag und wunderte sich, weswegen sein Freund ihn hatte schlafen lassen.
Was war es für eine Nacht gewesen! Es war ihm schwergefallen, einzuschlafen, aber nach einiger Zeit hatte ihn das Rauschen des Windes und das Klatschen des Regens so müde gemacht, dass er sich nicht mehr hatte halten können.
Draußen hörte er das Schreien und Quieken der Kinder und das Platschen von Wasser. Ihn wunderte diese Ausgelassenheit, mit der die Kinder draußen spielten. Er konnte sich noch gut daran erinnern, dass er und Tsam durch teilweise riesige Pfützen gesprungen waren. Tsam war einmal in eine Pfütze gesprungen, die so tief gewesen war, dass sie ihm über das Knie reichte, und der Schlamm am Boden hatte ihn einsacken lassen. Er hatte wie erstarrt dagestanden und zugelassen, wie der Boden unter seinen Füßen immer weiter nachgegeben und ihn tiefer hatte einsacken lassen. Erst viel später hatte er versucht, sich zu befreien, was zu spät gewesen war. Tsam war so tief im Schlamm eingesunken, dass er sich nicht mehr hatte rühren können und zu Schreien angefangen hatte. Acht oder neun Jahre alt mochten sie damals gewesen sein und beide hatten geglaubt, dass die Erde Tsam hatte verschlucken wollen. Und beim Himmel, was hatte er geschrien! So laut und so markdurchdringend, dass das halbe Dorf herbeigeeilt war und ihn herausgezogen hatte. Als er aus der Pfütze befreit war und noch immer weinte, war seine Mutter gekommen, hatte ihm zwei Ohrfeigen gegeben und ihm gesagt, dass es unglaublich dumm gewesen war, das zu tun, was er getan hatte. Tsam hatte einfach nur dagestanden und geheult und geheult, um nach einigen Minuten wieder durch die Pfützen zu toben, sich hineinzuwerfen und andere hineinzuzerren. Am gleichen Tag hatte er auch Jessica, die noch ein Kleinkind gewesen war, genommen und in Richtung Pfütze gezerrt. Sie hatte gebrüllt, geschlagen, getreten und gekratzt, und daraufhin hatte er sie einfach in hohem Bogen in eine Pfütze geworfen. Jessica hatte einen Krach geschlagen wie niemals zuvor und niemals danach. Als ihr Vater Lorn gekommen war, um Tsam einige Schläge ins Gesicht zu verpassen, hatte sie in der Pfütze gesessen und, nass und schmutzig wie sie war, vor Vergnügen auf das Wasser um sich geschlagen und einen Spaß gehabt, dass Tsam erst recht noch einmal zu weinen begonnen hatte.
Ach ja, die Pfützen. Mark hörte das Spritzen von Wasser, und er vermutete, dass sich die Kleinen durch das Wasser jagten und sich gegenseitig hineinwarfen, wenn sie jemanden fingen, so wie das immer geschah.
Er stand auf und sah hinaus, und sein Atem stockte ihm. Das Dorf hatte sich in eine Schlamm- und Wasserwüste verwandelt. Was nicht von Wasser bedeckt war, war so wässrig, dass jeder bis zu den Knien eingesackt wäre, und er sah zahlreiche Fußspuren darin. An den Häusern entlang sah er Bretter, auf denen man gehen konnte, um nicht im Schlamm zu versinken. Nach wie vor waren die Häuser verbarrikadiert, und es war ein ungewohnter und unangenehmer Anblick. Mark hatte niemals in seinem Leben dergleichen gesehen, denn wann hatte es schon einmal einen Grund dafür gegeben? Hier im Dorf, wo es nichts gegeben hatte außer den Menschen, den Tieren und der Stille, der Einsamkeit und der Abgeschiedenheit? Mark wurde wieder schwermütiger. Es gab da keine Erzählung, die ihn auf diese Szenen vorbereitet hatte, und innerlich sträubte sich etwas dagegen. Diese Barrikaden, die das Außen abgrenzten und aussperrten: welche Gefahr sollte dort draußen bloß sein? Von welcher Gefahr meinten sie alle, dass sie draußen irgendwo ihr Unwesen trieb?
Mark sah sich die Häuser unter dem schmutzigen Himmel an, der bald schon wieder Regen bringen würde. Sie waren dunkel, durchtränkt von Nässe und schwer wie alte Steine. Das Grün der Wiesen und Weiden war dunkel und nass, und so dankbar sie auch sein mochten über den Guss, der auf sie herabgestürzt war, so sehr hatte der Regen sie niedergedrückt, dass es Tage dauern würde, bis sie sich wieder aufrichteten.
Wo Tsam sich nur herumtreiben mochte? War er unten in der Küche und saß am Tisch wie ein Bruder, den Mark nie gehabt hatte?
Mochte Tsam dasitzen und die Lücke ausfüllen, die Jessica hinterlassen hatte? Jessica, eine Hexe, eine Andersartigkeit aus ihren eigenen Reihen – und Tsam, der diese Lücke gebührend ausfüllte, ja!
Er ging aus dem Zimmer. Wie er Treppe hinunter schritt, kam sich verlassen vor. Tsam hatte nicht im Bett neben ihm gelegen, und es war schon so unerträglich lange her, dass er aufgewacht war, ohne jemanden im Nebenbett liegen zu sehen. Das Haus kam ihm leer vor.
In der Wohnküche war niemand. Draußen spielten noch immer die Kinder. Konnte es sein, dass Tsam mitspielte?
Mark stellte sich Tsam von all den Kindern umringt durch die Pfützen tobend vor, wie er auf alle aufpasste.
Ihm wurde schwer ums Herz. Bis vor einigen Tagen noch wäre es keine Schwierigkeit gewesen, ihn darauf anzusprechen, und man hatte darüber gesprochen. Aber nun war eine Barriere zwischen ihnen, eine, die zwar nicht ihre Freundschaft zerstörte, aber eine, die sie eigenständiger werden ließ. Plötzlich kam das Gefühl der Peinlichkeit, dem anderen etwas Bestimmtes zu erzählen. Das Gefühl, sich der Lächerlichkeit preiszugeben.
Und so spielte Tsam wahrscheinlich draußen mit den Kindern und hatte ihn vergessen.
Nun, wenn schon niemand da war, so entschied sich Mark dennoch, zu frühstücken, und er wusch sich zuerst mit bereitgestelltem Wasser, um sich, nachdem er sich angezogen hatte, daran zu machen, sein Frühstück zuzubereiten.
Dann hörte er von draußen her wildes Geraune von Erwachsenen, aufgeregt und teilweise schrill, viele riefen durcheinander.
Mit einem Zug leerte er seinen Becher Milch und schritt mit polternden Schritten zur Tür. Draußen roch es nach nasser Erde. Aber da war noch etwas anderes in der Luft, geruchlos, mehr eine Vibration.
Die Kinder waren verstummt und hatten sich in einer Traube zusammengefunden, die ein paar Häuser links von ihm stand, wo einige Männer und Frauen zusammenstanden und gestikulierend miteinander sprachen. Immer mehr liefen über die feuchtdunklen Bretter am Boden, und bei jedem Schritt schmatzte das Wasser der Pfützen unter ihnen.
Sein Magen zog sich zusammen. Er machte sich auf den Weg, und obwohl er aufpassen musste, vom glitschigen Holz unter sich nicht abzurutschen, ließ er die ganze Zeit die Menge nicht aus den Augen. Je näher er kam, um so deutlicher sah er die entsetzten Gesichter, um so mehr Tränen sah er über mehr Gesichter rollen. Er sah, dass viele ihren Blick zu Boden gesenkt hatten. Er sah, dass viele die Hände vor das Gesicht schlugen und dort behielten, er sah die Kinder, die eben noch ausgelassen gewesen waren, weinten.
Mark lief immer schneller, und die Bretter beschrieben zu der Gruppe einen Umweg, er musste an ihr vorbei, an einigen Häusern entlang, bis er endlich zu der Gruppe stieß.
Graue Gesichter empfingen ihn, so grau wie der Himmel. Man schluckte, als man ihn kommen sah. Viele sahen ihn an und nahmen sofort den Blick wieder von ihm. Sein Vater kam ihm entgegen. Und als Lorn ihm berichtete, was geschehen war, spürte Mark, wie ihm sein Herz aus der Brust gerissen wurde.
Atemlose Stille wie nach dem Ende der Welt. Stille, die davon zeugte, dass nichts mehr lebte, nichts mehr war. Stille, die jenseits aller Zeiten das Ende aller Zeiten markierte. Mark stand am Wasser des zu einem Fluß angeschwollenen Bachs und sah dabei zu, wie Harban, der auf seine fünf Pferde stolz war, in das Wasser watete und bis zur Brust darin verschwand. Er zog an etwas, das sich in dichtem Buschwerk am Rand verfangen hatte, das sonst drei Meter vom Wasser entfernt den Bach säumte.
Ein Körper hing darin, und jeder von ihnen wusste, wer da aus dem Wasser gezogen wurde. Tsams Eltern schüttelten, die Mutter lag in den Armen eines Nachbarn, der sie tröstete, weil ihr Mann nicht dazu in der Lage war. Er stand betäubt da und konnte nur reglos zuschauen. Immer wieder tauchte Tsams Gesicht aus dem Wasser auf, während Harban versucht war, den Körper so sorgsam wie möglich aus dem Geäst zu befreien. Bei vielen der Umstehenden erschien Maramis Schatten kurz inter einem Baum, neben einem Strauch, einem Haus.
Nicht wenige schlossen ihre Augen.
Harban rief Verstärkung. Der Körper ließ sich nicht ohne Weiteres aus dem Geäst befreien, und sofort stürmten einige Männer zur Hilfe, auch Lorn gehörte dazu und war einer der Ersten neben Harban. Tsams Körper war eiskalt und die Haut von leicht gräulicher Farbe.
Im Wind standen alle wie Dolmen in der Landschaft und sahen dabei zu, wie sich unter knackendem Geäst Tsams Körper aus dem Gestrüpp löste und aus dem Wasser gezogen wurde, tot für alle Zeiten.
Nach einer Weile, an deren Länge sich Mark nie würde erinnern können, lag Tsam schließlich am Ufer und das Wasser rann an ihm herab. Seine Augen blickten ins Irgendwo, ohne jeden Ausdruck in die unendliche Ferne. So sehr Mark es sich wünschte, so sehr blieb sein Blick von Tsam unerwidert. Tsams Kleidung klebte ihm am Köper und hatte das Geäst nicht unbeschadet überstanden. Die Haare lagen nass am Schädel. Der Wind glitt über ihn hinweg, ohne etwas zu bewegen, einzig die Wimpern tanzten im Luftzug.
Sie alle traten näher heran, und auch Marks Beine trugen ihn näher an Tsam heran, um den die Männer im Schlamm knieten. Er sah Tirata erscheinen, man machte ihr Platz, und sie beugte sich zu Tsam herab, berührte seine Stirn, berührte seinen Hals, fuhr ihm durchs nasse Haar. Neben ihr stand Jessica, stumm und bleich.
Für Mark gab es keine Welt mehr. Im Fokus all dessen, was er sah, lag Tsam. Da gab es keine anderen, da gab es kein Dorf. Es gab kein Bach und kein Gras und keinen Schlamm und keinen Himmel. Da lag nur Tsam. Windböen rauschten in Marks Ohr, er spürte den Wind in seinen Haaren und sein Hemd aufblähen.
Mehr geschah nicht, scheinbar für Ewigkeiten. Mark blickte in die Augen von Tsam und fragte sich, was er wohl als Letztes gesehen haben mochte. Etwas war es gewesen, so oder so. Unscharfe Wasserwirbel vielleicht oder der Himmel, der Boden, Gras? Maraim etwa, der ihn ins Wasser gestoßen hatte? Was zeigten diese Augen? Furcht vielleicht oder Erlösung möglicherweise, Erstaunen? Tsams Augen verwehrten Mark die Antwort.
Vielleicht waren die Geister der Corrin-Höhle für all dies verantwortlich, der Mann vor der Höhle in Morkus‘ Buch: welchen Eindruck mochte er wohl auf Tsam in den letzten Sekunden gemacht haben? Hatte dieser Mann ihn hereingeworfen? Oder war es doch Maraim, wie alle befürchteten? Und wenn er Maraim gewesen war, war Maraim nun etwa der Mann vor der Höhle in Morkus‘ Buch? Dann war dieser Mann böse.
Nie gespürte Wut stieg in Mark empor und mischte sich in seine Trauer. Es war, als begänne sein Körper zu brennen – und dieses Feuer war es, das ihn dazu brachte, sich aus der Erstarrung zu lösen. Tränen stiegen in seine Augen, und er konnte nicht anders, als sie fließen zu lassen. Er sah all die Gesichter um sich herum. All diese Menschen hätten Vieles gegeben, um Tsam wieder zum Leben zu erwecken, und Mark hätte seine Beine geopfert.
In die Stille fraß sich etwas Neues in Trauer und Schmerz. Es war Hass. Hass gegen den, der das zu verantworten hatte. Oder gegen ein Etwas, und wenn es nur ein Stein war, der sich in Tsams Weg gelegt und sein Schicksal besiegelt haben mochte. Hass gegen den Mörder, der sich als Untoter an seinem eigenen Bruder gerächt hatte.
Mark wusste nicht mehr weiter. Er sah dabei zu, wie Harban Tsam aufhob und auf seinen beiden Armen trug, sah, wie Tsams Arme und Beine schlaff herunterhingen wie nasses Gras, wie Tsams Kopf mit seinen geöffneten Augen nach unten kippte. Sah, wie Tropfen von Tsams Leib zu Boden fielen. Sah, wie Harban, umringt und gefolgt von den anderen, Tsam in Richtung Dorf trug.
Mark konnte ihnen nicht folgen. Stattdessen wandte er sich ab und ging in die weiten Felder, in denen er mit Tsam so viel Zeit verbracht hatte. Er wandte sich zum Frauenbaum, der da einsam inmitten von im Wind wehendem Grün stand, und obgleich er nicht die Stimmen der Leute im Kopf hörte, die die vielen Geschichten über den Baum erzählten, so verband er mit diesem Baum doch etwas nie Gespürtes. Er und Tsam waren die einzigen Kinder gewesen, die ihn erklommen hatten, sogar einigen Male. Und jedes Mal war ein heiliges Kribbeln in ihnen aufgestiegen, ein Gefühl, als stießen sie zum Kern aller Schöpfung vor.
Sie hatten gemeint, damit Herrscher über das Schicksal zu werden. Dieser Nervenkitzel, die eigenen Finger in Rinde zu drücken, die nach den Geschichten älter war als jede Zeit, dieses Gefühl, auf Äste zu steigen, von denen man sich erzählte, dass dort mächtige Geister saßen, um von der Ferne das Dorf zu beobachten: all dies hatte Mark und Tsam zu Beherrschern des Unabwendbaren gemacht. Sie hatten ihren Mut zusammengenommen und hatten dem Ewigen und Wahren ins Auge geblickt und hatten sich darüber triumphiert, dass sich nie jemanden nahe genug an den Frauenbaum heran gewagt hätte, um sie zu verjagen.
Immer, wenn sie in dem Baum gesessen hatten, waren sie sich großartig vorgekommen, hatten sich mächtig gefühlt, weil sie etwas gewagt hatten, das niemand außer ihnen gewagt hätte. Und weil sie niemandem im Dorf darüber berichten konnten, da sie bestraft oder schlimmstenfalls gar gemieden worden wären. So hatten die beiden einträchtig mit dem Allgegenwärtigen ein Bündnis geschlossen: sie lebten mit ihm, und es ließ sie in Ruhe.
Bis jetzt.
Der Wind um Mark schien Geräusche Tsams mit sich zu tragen. Mark hörte seine Schritte hinter sich, hörte das Gras rascheln, als liefe Tsam hindurch, hörte Zweige brechen, so als träte Tsam auf sie. Mark verlor sich in diese Vorstellungen, während er weiter ging, doch immer wenn er sich umblickte und meinte, Tsam ganz selbstverständlich hinter sich zu sehen, wie er ihm gut gelaunt folgte, musste er erkennen, dass Tsam nicht hinter ihm war, ihm nicht folgte, nicht mehr bei ihm war.
Er kam dem Frauenbaum näher und sah an ihm hoch. Der Wind keuchte durch die Äste. Mark spürte den Wind in seinen tränennassen Augen. War ihm der Baum bislang stets wie ein Freund vorgekommen, so schien dieser Freund dieses mal seine Gestalt verändert zu haben. »Ich habe auf dich gewartet«, sagte der Baum zu Mark.. »Ich dulde niemanden neben mir. Ich dulde niemanden.«
Mark holte tief Luft, und es kostete ihn Kraft, sich davon zu überzeugen, dass diese Worte nur eingebildet gewesen waren. Der Frauenbaum war mächtig und böse, wie er den Wind als Stimme benutzte. Warum war Mark nur nie aufgefallen, dass dieser Baum tatsächlich furchterregend aussah?
Scharfe Windböen schleuderten durch Marks Haare, und das Laub des Frauenbaums zischte.
Mit all seiner Wut trat Mark den Stamm des Baumes, er knickte Äste ab. An die dicken hängte er sich oder kletterte auf sie, um auf ihnen herumzuspringen, bis sie abbrachen. In seiner blinden Wut wollte er den Baum zerstören, wie dieser auch sein Leben zerstört hatte. Was gab es für Mark nun noch im Dorf? Plötzlich spürte er, wie klein und erbärmlich das sonst heimatliche Dorf doch war. Was gab es hier schon? Tsam war tot. Sein Freund war fort, und es gab nichts mehr, was ihn noch hier hielt. Warum nicht fortgehen? Warum nicht dort hingehen, wo Tsam vielleicht nun leben mochte, weit entfernt, wo die Sonne jeden Morgen aufstieg oder unterging?
Was hielt ihn nun noch im Dorf? Alle dort fürchteten sich vor Geistern, fürchteten die Rache von Maraim, den sie selbst vertrieben hatten. Alles schien sich nun für all die Trägheit rächen zu wollen, in der das Dorf seit Menschengedenken lag.
Alles wollt der Wind von Irgendwo ändern, indem er über das Land brauste und alle mit sich riss, einen Loch in ihr Leben blies, sie aushöhlte und alle Wünsche, Träume und Sehnsüchte mit sich riss, wenn sie nicht willens waren, ihm zu folgen, dorthin, wo er alles, was er ihnen genommen hatte, ablud. Das Dorf war und blieb ein Ort des Vergessens. Und Mark wollte fort von hier. Aber vorher wollte er all die Geheimnisse lüften, die über allem lagen. Er wollte in die Corrin-Höhle gehen. Er wollte sehen, was sich dort Fremdes verbarg, und ob gemeinsam mit anderen oder allein – er wollte wissen!
Als er diesen Entschluss gefasst hatte, bemerkte er, dass er in seiner Wut den Baum zerstört hatte. Seine Äste lagen auf dem Boden, zerbrochen und zertreten. Er betrachtete sein Werk und fand, dass es gut war, und lief zum Dorf zurück, um den anderen von seinem Vorhaben zu berichten.



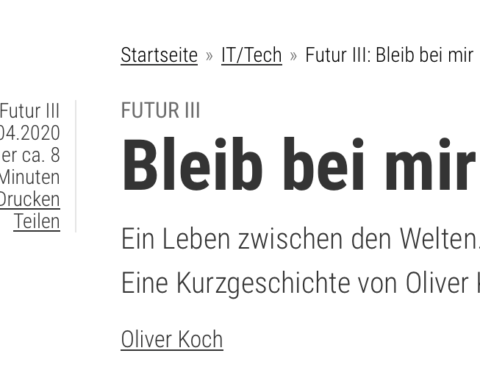







[…] Am FeuerKapitel 10: Beginn einer OdysseeKapitel 11: Die Geißel der AngstKapitel 12: GewitternachtKapitel 13: Der FrauenbaumKapitel 14: Der Mut der VerzweiflungKapitel 15: Der Wind von […]